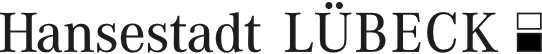Festrede von Klaus Wagenbach zum 80. Geburtstag von Günter Grass in Lübeck
Der Schriftsteller, Verleger und Freund Klaus Wagenbach hielt bei der Festveranstaltung anlässlich des achtzigsten Geburtstages von Günter Grass am 27. Oktober 2007 im Lübecker Theater folgende Festrede:
„Die mir zugemessene Viertelstunde möchte ich als Zeit- und Generationszeuge nutzen. An Jahren trennt Günter Grass und mich wenig – drei Jahre –, an Herkunft viel: Grass war Autodidakt und kam aus einer kleinbürgerlichen Nazifamilie, ich kam aus einer bürgerlichen Antinazifamilie und war Germanist – eine Profession, der Grass bekanntlich nicht besonders zugetan ist. Wir haben uns Ende der fünfziger Jahre kennengelernt und wurden trotz dieser Unterschiede bald enge Freunde. Der Grund war sehr einfach: Wir waren weder mit dem damaligen Literaturkanon noch mit dem damaligen Zustand der Bundesrepublik einverstanden. Außerdem waren wir Pilzsammler.
Ich könnte also erzählen, wie wir in die mageren Westberliner Wälder zogen, ohne Frauen, aber mit fünf Kindern, die Grass entgegenkommenden Pilzsammlern stets mit den Worten vorstellte: „Haben wir alle gemeinsam gemacht.“
Oder wie ich, als Lektor eines ganz anderen Verlages, die „Hundejahre“, die mir zu umfangreich schienen, um einige Kapitel kürzte, was er akzeptierte (ein besonders eitler Autor ist Grass nicht). Aber in der Widmung der „Hundejahre“ heißt es dann doch: „Für die fehlenden Kapitel ist der Setzer verantwortlich.“
Und erzählen könnte ich schließlich (und ich tue es schnell) die große, unerwartete Freundestat von Günter, als er – nachdem ich als Lektor aus „zeittypischen“ Gründen entlassen worden war – mich tröstete, mir aus der Hand las, dass ich einmal ein großer Verleger werden würde und das gleich damit beförderte, dass er zu Beginn des Verlages im März 1965 mit mir auf Verkaufsreise ging, in ein Dutzend Buchhandlungen von Itzehoe bis München, vorsorglich mit vielen Büchern im Auto, denn die meisten Buchhändler hatten nur sein Buch – „Onkel, Onkel“ – bestellt. Denen ließ er keine Ausrede durchgehen: Er las Bobrowski oder Bachmann vor, ich holte deren Bücher aus dem Auto, er informierte die Buchhändler und Zuhörer inzwischen über den Verlag und die SPD, danach sangen wir noch das „Onkel“-Lied – und schon war der Verlag wieder etwas liquider.
Das könnte ich erzählen. Ich erzähle aber etwas anderes. Die Geschichte beginnt in den frühen sechziger Jahren auf einer Terrasse in Vira im Tessin beim ausgiebigen Skatspiel. Darin war Grass Meister und konnte sich dadurch beiläufig für meine Kritik an seiner Kochkunst rächen. An diesen Abenden entstand das Projekt einer kurzen Biographie, die 1964 hätte erscheinen sollen. Grass war damals zwar ein bereits weltberühmter, in viele Sprachen übersetzter Autor; eine Biographie gab es aber noch nicht. Das Projekt kam wegen meiner Entlassung nicht zustande.
Im April dieses Jahres stieß ich beim Aufräumen auf ein kleines Konvolut mit meinen damaligen Notizen. Wären sie mir ein paar Monate früher in die Hände gefallen, hätte ich eine der hinterlistigsten journalistischen Untaten in jüngerer Zeit zumindest kommentieren können. Ich fand nämlich in meinen Notizen die genaue Beschreibung des Wegs von Grass in den letzten Kriegsmonaten: Vom Freiwilligen, der (wie die meisten Danziger) zur Marine wollte, die es aber praktisch nicht mehr gab, sodass man ihn, siebzehn Jahre alt, der Waffen-SS zuteilte, als Kanonenfutter.
Hinter den neuerlichen Angriffen auf Grass steht freilich auch eine Strategie: Sind einmal die linken Ikonen – mögen sie Habermas, Grass oder Mitscherlich heißen – diskreditiert, so wird damit auch ihre Kritik an deutschen Zuständen obsolet. Folgerichtig erscheinen die frühen Jahre der Bundesrepublik in schönerem Licht, das dann konsequent weiter aufgehellt wird, etwa mit so seltsamen Figuren wie Joachim C.Fest, der sich nicht von ungefähr vom NS-Bau- und Rüstungsminister Albert Speer die schönsten Lügen hat erzählen lassen.
Inzwischen werfe ich noch einmal einen Blick in meine alten Notizen und stelle mir vor, was wir daraus erfahren hätten, wenn sie 1964 als Buch erschienen wären. Wir hätten eben nicht nur von einem überzeugten Hitlerjungen erfahren. Wir hätten auch von einem Schüler erfahren, der nächtelang Geschichtstabellen verfasste, als Versuch, gegenüber der in der Schule ausschließlich gelehrten deutschen Geschichte historische Proportionen zurückzugewinnen.
Wir könnten den abenteuerlichen Lektüren des Schülers folgen, beginnend mit Schenzinger, Thiess, Dominik, Freytag und Dahn, denen dann in der Nachkriegszeit dermaßen viele Autoren und Bücher folgten, dass sie fast ein ganzes Blatt meiner Notizen füllten, von Lorca, Eluard und Apollinaire bis Faulkner, Kafka und Vittorinis „Gespräch in Sizilien“. Ausgeliehen in Caritasheimen, bei Bekannten, in Klosterbibliotheken von einem allein, immer noch in umgefärbten Militärklamotten durch Westdeutschland vagabundierenden Neunzehnjährigen auf der Suche nach seinen Eltern, die er erst zwei Jahre nach Kriegsende wiederfand.
Wir hätten einen Neunzehnjährigen vor Augen, der 1946/7 in der Burbach Kali AG, Werk Siegfried, Großgiesen zum erstenmal Diskussionen zwischen sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeitern ebenso zuhört wie den Reden Kurt Schumachers, auch wenn sie ihm zu laut waren. Kurz: einen jungen Mann, der sich in der Kinderstube der Republik zurechtzufinden versucht.
Aber diese Kinderstube roch nach Turnhalle und Besserungsanstalt. Da boten die 1951 ausgestellten Reisepässe die erste Möglichkeit, das Land zu verlassen und Günter Grass machte, wie viele andere, sofort davon Gebrauch. Wie er es freilich geschafft hat, mit der allgemeinen Kopfquote von 300 D-Mark vier Monate in Italien zu bleiben, habe ich immer bewundert - allerdings konnte er sich als Maler noch einen kleinen Nebenverdienst verschaffen, mit einer Leuchtschriftreklame für Butangas. Italien war damals für viele junge Leute fast selbstverständlich das begehrteste Reiseziel, insbesondere für einen angehenden Bildhauer, der die Originale sehen wollte.
Wer zu jener Zeit als Deutscher mit schmaler Börse und per Autostop durch Italien reiste, machte aber auch einige politische Erfahrungen, zumindest zwei: die berühmte Erfahrung nichtliquidatorischer Diskussionen unter politischen Gegnern und die Erfahrung einer großen und selbstbewussten kommunistischen Partei, der die meisten Künstler und Intellektuellen angehörten.
Das Deutschland, in das Grass zurückkam, nannte er später „die fünfziger Jahre der Persilscheine“. Nirgends Täter, überall Mitläufer. Eine Gesellschaft zwischen Waschzwang und Erziehungsfuror, mit der fatalen Sehnsucht nach Geborgenheit und einer Ordnung, die sich gegenüber freieren Köpfen sofort als Bevormundung demaskierte. So gab es immer noch die, wie sie Grass nannte, „Schummelwörter“: Die Vergangenheit hieß dann das „Entsetzliche“ oder der „Höllenspuk“, in der Politik regierte das „Schicksal“, in der Literatur „das Unfassbare“, in der Germanistik das „Numinose“. Die erfolgreichste Anthologie der fünfziger Jahre hieß „Ergriffenes Dasein“. Viel Ergriffenheit, wenig Begreifen. Nicht zu vergessen die Philosophie, wo ebenfalls das Raunen vorherrschte, an der Spitze Martin Heidegger, mit so närrischen Behauptungen wie Dichtung ist „worthafte Stiftung des Seins“ und „spricht aus einer zweideutigen Zweideutigkeit“. Grass antwortete darauf in den „Hundejahren“.
Neben den Schummelwörtern und dem altdeutschen Gemurmel waren freilich auch noch die Fanfaren der Nazizeit zu hören, beispielsweise das Laute und Schmetternde in den „Wochenschauen“. So hat es mich auch nicht gewundert, dass die Öffentlichkeit erst vor wenigen Monaten erfuhr, die Mitarbeiter des Bundeskriminalamts seien mehrheitlich in der SS gewesen – man brauchte das damals nicht zu wissen, man konnte es hören.
Umso mehr konnte man sehen, was die Remilitarisierung bewirkte und mit welchen Mitteln sie durchgesetzt wurde, bis zum Verbot (1952) einer Volksbefragung zur Wiederbewaffnung und dem Verbot der kommunistischen Partei (1956), ein unikaler Fall in Westeuropa und – sieht man auf die 2,2 % bei der Wahl zuvor – ein besonders lächerlicher Fall. Aber bezeichnend für die berüchtigte deutsche Neigung zur Panik. Im gleichen Jahr wurde übrigens das Tragen von Nazi-Orden wieder erlaubt, allerdings mit der Auflage, das Hakenkreuz abzufeilen – wir sind eben auch (im doppelten Wortsinn) ein putzsüchtiges Volk ... Grass kam in „Katz und Maus“ darauf zurück.
Das Erscheinen der „Blechtrommel“ im Herbst 1959 war dann in der Tat ein Epochenbruch. Junge Kritiker wie Joachim Kaiser oder Hans Magnus Enzensberger begrüßten das Buch mit ausführlichen Rezensionen, ältere Kritiker antworteten mit herben Verrissen, wie etwa Günter Blöcker, der Starkritiker der FAZ, der allerdings noch 1960 Gerd Gaiser für den bedeutendsten Nachkriegsschriftsteller hielt. Der Erfolg der „Blechtrommel“ war dennoch außerordentlich. Die Leser stürmten die Buchhandlungen, um ein Buch zu erwerben, das in Anlage und Wirkung eine „Aufforderung zum großen Mundaufmachen“ war - dies ist auch der Titel eines Gedichts aus der selben Zeit:
Wer jene Fäulnis,
die lange hinter der Zahnpaste lebte,
freigeben, ausatmen will,
muß seinen Mund aufmachen
Hier schrieb ein Autor, den Tabuzonen geradezu reizten, weil er in ihnen, ganz zu Recht, auch die Gründe für die Wunde seines jugendlichen Irrtums vermutet. Seine Fragen waren die Fragen junger Leute: Was wird uns verschwiegen? Warum werden wir gegängelt?
Es ist deswegen irrig (wenn auch neuerdings in Mode), den jungen Grass für ,unpolitisch’ zu halten. Die „Blechtrommel“ selbst ist ja ein durch und durch politisches Buch und ihr Autor nahm auch schon wenige Monate später, kaum dass er „Autor“ geworden war, an der öffentlichen politischen Diskussion teil, mit der Unterschrift unter ein Manifest . Es handelte sich um eine Solidaritätserklärung für 121 französische Intellektuelle, die zur Desertion im Algerienkrieg aufgefordert hatten. In Deutschland wurde daraus vom seinerzeitigen Literaturpapst Sieburg ein Skandal gemacht; er empfahl den „keineswegs repräsentativen“ Unterzeichnern zu diesem Streit „in einem anderen Land“ den Mund zu halten. Grass kannte aber die blutigen Razzien der Pariser Polizei gegen die Algerier aus eigener Anschauung und machte den Mund auf.
Der nächste, folgenreiche Anstoß war die Beleidigung des Berliner Bürgermeisters (und SPD-Kanzlerkandidaten) Willy Brandt durch den Bundeskanzler Konrad Adenauer im Wahlkampf 1961: Brandt sei ein uneheliches Kind und habe eine norwegische Uniform getragen. Beide Argumente muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Das eine richtete sich an die Spießer, das zweite richtete sich an alle, die keine norwegische Uniform getragen hatten, sondern eine deutsche. Von beidem gab es genug und so wurde Adenauer auch gewählt. Wieder machte Grass den Mund auf und diesmal im großen Stil und auf eigene Kosten, literarisch wie politisch; ich will das nicht weiter ausführen. Leider haben Günter und ich uns 1972 furchtbar zerstritten, er als unverbesserlicher Sozialdemokrat und ich als unverbesserlicher Libertärer.
Wir kamen erst 1989 wieder zusammen, aus einem ganz pragmatischen Anlass, aber ich erzähle ihn gern (und als letztes), weil es ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die außerordentliche Zivilcourage des damals schon über Sechzigjährigen ist. Es ging um das Buch „Die satanischen Verse“ und seinen Autor Salman Rushdie, der von Ayatollah Khomeini zum Tode verurteilt worden war. Das Buch wagte niemand zu veröffentlichen, und so begannen Michael Naumann vom Rowohlt Verlag und ich bei Kollegen für eine Gemeinschaftsausgabe deutscher Verlage zu werben. Ich versage es mir, die Ausreden, die wir hörten, zu berichten. Ganz zu schweigen von den Ausreden unserer tapferen deutschen Presse, die, zur Veröffentlichung von Exzerpten aus dem Buch aufgefordert, sich auf das Copyright-Argument zurückzog: man könne nicht unautorisierte Texte abdrucken. Die Wahrheit kam freilich mit dem Erscheinen der Gemeinschaftsausgabe ans Licht – auf den ersten beiden Seiten mit den Namen der Herausgeber fehlen sämtliche Tageszeitungen, mit der großen und ehrenvollen Ausnahme der „taz“.
Wie überhaupt diese Namensliste auch als Liste der Schande gelesen werden kann...
Günter Grass hatte ebenfalls viele Autoren als Herausgeber der Gemeinschaftsausgabe geworben und plante eine öffentliche Lesung an der Berliner Akademie der Künste, deren Mitglied er war. Die Lesung wurde abgelehnt, Grass trat aus der Akademie aus und wir mieteten als Ersatz einen Gasthaussaal in der Hasenheide.
Zur Veranstaltung fanden wir ihn überfüllt vor, auch mit ziemlich ungemütlichen Leuten. Als wir, mit einigen Kollegen, als günstige Zielscheiben auf dem Podium Platz genommen hatten, sagte ich mir im Stillen (und zum erstenmal in meinem Leben): „Wie schön dass auch Polizei da ist.“
Günter aber, als sei nichts, begann aus Rushdies „Mitternachtskindern“ zu lesen und gewann schließlich fast den gesamten Saal als Zuhörer, ein staunens- und bewundernswertes Schauspiel.
Ich füge nichts weiter hinzu als: Günter Grass hat die Bundesrepublik ziviler, freier und demokratischer gemacht, kurz: bewohnbarer.“ +++