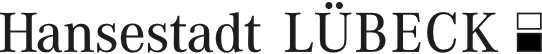Weiß-Tanne
Abies alba - Baum des Jahres 2004

In Lübeck war wieder einmal Weihnachtsmarkt. »Und wo man ging, atmete man mit dem Duft der zum Kauf angebotenen Bäume das Aroma des Festes ein.« Mit den Bäumen, die Thomas Mann an dieser Stelle der Buddenbrooks erwähnt, meinte er meine Familie und mich: die Tanne – den klassischen Weihnachtsbaum. Seit dem 19. Jahrhundert habe ich mich in Deutschland zu dem entwickelt, was auch die Familie Buddenbrook an mir schätzte: ich bin der leuchtende Mittelpunkt des Fests.
Woher der Brauch ursprünglich stammt, weiß allerdings niemand so genau. Selbst Experten mühen sich, seinen Ursprung zu finden. Ich höre immer wieder, dass die These, er gehe auf das heidnisch-germanische Julfest zurück, wissenschaftlich nicht zu halten ist. Früheste Belege über einen Tannenbaum zum Fest tauchen in der Mitte des 16. Jahrhunderts bei den Zünften auf. Seitdem zog der Brauch allmählich in die Familien wohlhabender Bürger ein. Bis er sich dann soweit durchgesetzt hatte, dass er vor rund 100 Jahren weltweit leuchtende Augen provozierte. So wie bei Hanno Buddenbrook, der sehnlich hofft, dass eine Puppenstube unter dem gewaltigen Tannenbaum liegt, der im sogenannten Götterzimmer des Hauses aufgebaut war »... geschmückt mit Silberflitter und weißen Lilien – und an der Spitze ein schimmernder Engel.«
Wenn Sie von einer Tanne sprechen, meinen Sie mich – die Weiß-Tanne. Sprechen Sie von einer Rottanne, meinen Sie eine Fichte. In der Alltagssprache ist es jedoch immer bei Tanne und Fichte geblieben. Ein weihnachtlicher Tannenbaum kann allerdings beides sein. Der kleine, feine Unterschied ist: ich nadele nicht. Und wo wir schon mal bei den Unterschieden sind: ich werfe weder meine Tannenzapfen ab, noch ist mein Holz harzig. Alle Zapfen, die Sie also auf dem Waldboden finden, sind Fichtenzapfen. Und über klebrige, harzige Flecken beschweren Sie sich bitte nicht bei mir.
Gemeinsam mit der Fichte gehöre ich allerdings zu den Giganten Mitteleuropas. Ich selbst werde bis zu 60 Meter hoch. Damit ich bei dieser Größe standhaft bleibe, verankere ich mich mit tiefen Pfahlwurzeln fest im Erdreich. Besonders ist, dass ich ein Schattenkeimer bin, der auch dort überleben kann, wo es für die Keimlinge anderer Bäume noch zu dunkel ist. Ich habe dazu ein ganzes Arsenal von Tricks auf Lager: erstens wachsen meine Äste dann nicht in die Höhe, sondern breiten sich horizontal aus. Dann entwickele ich Schattennadeln und reduziere schließlich meine Lebensfunktionen auf ein Minimum. So kommt es, dass ich bis zu 100 Jahre in eine Art Schlaf fallen kann. Was ich bei einer Alterserwartung von bis zu 600 Jahren vertretbar finde. Bekomme ich dann irgendwann genug Licht – zum Beispiel, weil Altbäume fallen oder gefällt werden – ist mein Dornröschenschlaf zu Ende. Dann wandele ich meine Schattennadeln in Lichtnadeln um und wachse in die Höhe. Und zwar mit Karacho.
Dort, wo ich gemeinsam mit Fichten und Buchen wachse, bilden wir so genannte Bergmischwälder. Sie sind sehr vielfältig und ertragreich. Da wir kein so dichtes Kronendach bilden, bieten wir auch Kräutern und Sträuchern in niedrigeren Wald-Etagen Gelegenheit, sich zu entfalten. Und wenn dann noch junge Bäume nachwachsen können, entwickelt sich so ein Bergmischwald irgendwann zu einer vielgestaltigen Waldgesellschaft. Der Förster nennt das dann »Plenterwald«.
Soweit das Ideal. Die Bedingungen sind für mich jedoch mittlerweile so, dass ich zu den Bäumen zähle, die auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft werden. Als man 1989 eine bundesweite Waldinventur machte, kam das ganze Drama ans Licht. Ursachen dafür sind Kahlschläge, Wildverbiss und diese verdammten Emissionen. Ausgerechnet hier wird mir die lange Lebensdauer meiner Nadeln zum Verhängnis. Denn anders als bei anderen Nadelbäumen wechsele ich mein Nadelkleid nur alle sieben bis elf Jahre. Kein Wunder also, dass es mehr Schmutz abbekommt. Mittlerweile haben die verringerten Emissionen meine missliche Lage zwar etwas gemildert – das Thema ist für mich aber noch lange nicht durch. Nichts für ungut, aber denken Sie doch auch mal an mich, bevor Sie in Ihr Auto steigen.