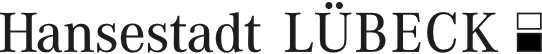- Bürgerservice
- Rathaus
Rathaus
- Rathaus
- Karriereportal
- Politik
- Verwaltung
- Verwaltung
- Antidiskriminierung bei der Hansestadt Lübeck
- Bürgermeisterkanzlei
- Büro der Bürgerschaft
- Feuerwehr
- Finanzen
- Frauenbüro
- Friedhöfe
- Gebäudemanagement
- Gesundheitsamt
- Gesundheitsamt
- Infektionsschutz und Hygiene
- Infektionsschutz und Hygiene
- Übertragbare Krankheiten
- Fragen und Antworten (FAQ)
- Hygieneüberwachung
- Tuberkuloseberatung
- Impfungen
- Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- Zahnärztlicher Dienst
- Amtsärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit
- Weitere Aufgaben
- Ihre Meinung zählt
- Tag der seelischen Gesundheit
- Konzernstruktur
- Kurbetrieb Travemünde
- Lübeck Port Authority
- Ordnungsamt
- Recht
- Soziale Sicherung
- Stabsstelle Migration und Ehrenamt
- Stadtgrün und Verkehr
- Stadtplanung und Bauordnung
- Stadtteilkonferenzen
- Stadtwald
- Standesamt
- Statistik
- Stiftungsverwaltung
- Straßenverkehrsbehörde
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Naturschutz
- Naturschutz
- Schutzgebiete
- Schutzgebiete
- Naturdenkmale flächenhaft
- Naturdenkmale objektbezogen
- Naturdenkmale objektbezogen
- Hängebuche in der Gärtnergasse
- Silberlinde am Koberg
- Ginkgo am Lindenplatz
- Bäume auf dem Jerusalemsberg
- Platanen auf dem Burgtorfriedhof
- Eichen am Waldsaum
- Lindenallee zum Gut Strecknitz
- Eichen- und Lindenallee in Padelügge
- Eichen vor der Schule in Niendorf
- Eichen auf dem Jahnplatz
- Natura 2000-Gebiete
- Geschützte Landschaftsbestandteile
- Naturschutzgebiete
- Landschaftsschutzgebiete
- Arten- und Biotopschutz
- Landschaftsplanung
- Erholung und Natur
- Projekte
- Klima
- Wasser
- Abfall
- Boden
- Lebensmittelüberwachung
- Veterinärwesen
- Gesundheitlicher Umweltschutz
- Hilfe in Notlagen
- Wirtschaft und Liegenschaften
- Wohnraum für Studierende
- Lübeck international
- Stadtleben
Stadtleben
- Stadtleben
- Familie und Bildung
- Familie und Bildung
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Stillfreundliche Stadt
- Beratung und Bildung
- Beratung und Bildung
- Beratung in der Schwangerschaft
- Willkommensbesuche
- Beratungsstellen Frühe Hilfen
- Familienzentren
- Familienzentren
- Familienzentrum / Kita Brüder-Grimm-Ring
- Familienzentrum / Kita Familienkiste
- Familienzentrum / Kita Schaluppenweg
- Familienzentrum / Kita Willy Brandt
- Familienzentrum / Kita St. Bonifatius
- AWO-Familienzentrum / Kita Redderkoppel
- Familienzentrum / Kinderhaus Pellwormstraße
- Familienzentrum / Kita Behaimring
- Familienzentrum / Kita Dreifaltigkeit
- Familienzentrum / Kita Helene Bresslau
- Familienzentrum / Kita Haus Barbara
- AWO-Familienzentrum / Kita Drachennest III
- Familienzentrum / Kita Kinderstube - Travemünde
- Familienzentrum / Kita Sprungtuch e.V. BunteKuh
- Familienzentrum / Kita Beim Meilenstein
- Familienzentrum Kinderhaus Alsheide
- Familienzentrum / Kinderclub
- Familienwegweiser
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen Jugendamt
- Familienbildung
- Telefon-Hotlines
- Beratungsstellen für Familien
- Kindertagesbetreuung
- Jugendamt
- Finanzielle Unterstützung
- Elterngeld/Kindergeld
- Freizeit
- Kinder von 3 - 6
- Kinder von 6 - 12
- Kinder von 6 - 12
- Schule
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Beratung und Unterstützung
- Beratung und Unterstützung
- Finanzielle Unterstützung
- Hilfe und Tipps für Kinder und Jugendliche
- Beratungsstellen für Familien
- Schulpsychologische Beratungsstelle
- Schulsozialarbeit
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen des Jugendamtes
- Telefon-Hotlines
- Familienservice
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Jugendamt
- Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Jugendliche
- Jugendliche
- Schule
- Schule und dann?
- Berufsausbildung
- Studium
- Jugendarbeit
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Jugendamt
- Beratung und Unterstützung
- Kinder- und Jugendbeteiligung
- Weitere Angebote
- Kinder- und Jugendschutz
- Sport
- Erwachsene
- Bildungsplanung
- Tourismus
- Tourismus
- Lübeck
- Travemünde
- Travemünde
- 200 Jahre Ostseebad
- Schiffe gucken
- Sehenswertes in Travemünde
- Strandleben
- Stadtplan Travemünde
- Travemünder Woche
- Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr
- Freizeit
- Freizeit
- LübeckCard
- Mobilität
- Lübecker Schwimmbäder
- Natur erleben
- Grünanlagen und Spielplätze
- Grünanlagen und Spielplätze
- Stadteingänge
- Patenschaften
- Private Feiern im öffentlichen Grün
- Grillen in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Baum des Jahres
- Baum des Jahres
- Stiel-Eiche
- Rot-Buche
- Sommer-Linde
- Berg-Ulme
- Speierling
- Gewöhnliche Eibe
- Spitz-Ahorn
- Hainbuche
- Eberesche
- Wild-Birne
- Silber-Weide
- Sandbirke
- Gewöhnliche Esche
- Gewöhnlicher Wacholder
- Schwarz-Erle
- Weiß-Tanne
- Rosskastanie
- Schwarz-Pappel
- Wald-Kiefer
- Walnuss
- Berg-Ahorn
- Vogel-Kirsche
- Elsbeere
- Europäische Lärche
- Wild-Apfel
- Trauben-Eiche
- Feld-Ahorn
- Winter-Linde
- Fichte
- Esskastanie
- Flatterulme
- Robinie
- Stechpalme
- Rot-Buche
- Moor-Birke
- Mehlbeere
- Roteiche
- Karte Baum des Jahres
- Schnullerbaum
- Baumkataster
- Klimabäume
- Baumspende
- Habitatbäume
- Anders parken – Bäume schützen
- Grün- und Parkanlagen
- Stadtnahe Erholung
- Spielen in der Stadt
- Sport
- Wochenmärkte
- Weihnachtsmärkte
- Schwimm- und Badegewässer
- Laternenumzug
- Kultur
- Kultur
- Museen
- Museen
- Museum Holstentor
- Buddenbrookhaus
- Günter Grass-Haus
- Kunsthalle St. Annen
- Museum Behnhaus Drägerhaus
- Willy-Brandt-Haus
- Museum für Natur und Umwelt
- KOLK 17 Figurentheater & Museum
- Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk
- Grenzmuseum
- Europäisches Hansemuseum
- Katharinenkirche
- St. Annen-Museum
- Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck
- Niederegger Marzipansalon
- Museum Alter Leuchtturm Travemünde
- Overbeck-Gesellschaft
- Museum Haus Hansestadt Danzig
- Theater
- Musik- & Kongresshalle
- Schleswig-Holstein Musik Festival
- Nordische Filmtage Lübeck
- Musikhochschule
- Bibliothek der Hansestadt Lübeck
- Stadtarchiv
- Kulturbüro
- Historische Pflaster
- Archäologie und Denkmalpflege
- Stolpersteine
- Galerien
- Filmstadt Lübeck
- Gedenkstätte Lübecker Märtyrer
- Wissenschaftspfad
- Kolosseum Lübeck
- Wohnen in Lübeck
- Veranstaltungen
- Stadtentwicklung
Stadtentwicklung
- Stadtentwicklung
- Lärmschutz
- Radverkehr
- Klima
- Klima
- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel
- Nachhaltigkeit
- Klimafonds
- Smart City Lübeck
- Smart City Lübeck
- Smart City Family
- Projekte und Maßnahmen
- Wir digital für Lübeck
- Digitale Strategie
- Smart City Infrastruktur
- Beteiligung
- überMORGEN
- überMORGEN
- Stadtentwicklungsdialog
- Rahmenplan und Mobilitätskonzept Innenstadt
- Verkehrsentwicklungsplan
- Stadtteilveranstaltungen
- Flächennutzungsplan
- Radverkehrskonzept
- Hafenentwicklungsplan
- Touristisches Entwicklungskonzept
- Kommunales Integrationskonzept
- Umfrage Klimaschutzmaßnahmen für 2021
- Masterplan Klimaschutz
- Übergangsweise
- Wirtschaftsförderung
- Priwall-Promenade
- Stadtplanung
- Stadtplanung
- Einzelhandelskonzepte
- Gewerbeflächen
- Wohnungsmarktberichte
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Verkehrskonzepte / ÖPNV
- Lübeck 2030
- Aktuelle Wohnbauprojekte
- Wohnquartier Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld
- Gründungsviertel
- Bauleitplanung
- Städtebauförderung
- Infrastruktur
- Stadtbildpflege
- Verkehrsmanagementsystem
- Hafen Lübeck
- Sportentwicklung
- Fehmarnbeltquerung
- Presse
Vorlage - VO/2016/03722
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag
Die Ergebnisse eines weiteren Gutachtens zur Aufstellung eines neuen Hafenentwicklungsplans (HEP) bis 2030 liegen vor und werden in diesem Bericht zusammengefasst. Es handelt sich hierbei um das Gutachten „Plausibilitätsprüfung und Fortschreibung der Seeverkehrsprognose 2030 für Lübeck„ (Gutachten 3).
Begründung
1 Allgemeines
Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hat am 28.11.2013 unter TOP 10.6 (VO/2013/00904) den Bürgermeister beauftragt, für den Prognosezeitraum bis 2030 einen neuen Hafenentwicklungsplan (HEP) aufzustellen. Die LPA hat hierzu eine Grundstruktur für die Bearbeitung des HEP 2030 aufgestellt. Demnach werden gem. den nachfolgenden Schaubildern im Block 2 die Grundlagendaten vor der eigentlichen Bearbeitung des Hafenentwicklungsplans im Block 4 erhoben. Die Ergebnisse des Gutachtens 3 liegen mittlerweile vor und werden in diesem Bericht zusammengefasst.

Abb. 1 – Grundstruktur HEP2030

Abb. 2 – Grundstruktur Block 2 HEP2030
Die Ergebnisse der Gutachten 1 und 2 wurden bereits mit Bericht vom 01.06.2015 (VO/2015/02673) der Bürgerschaft vorgestellt. Die Ergebnisse des Gutachtens 7 (VO/2016/03552) und des Gutachtens 4 (VO/2016/03550) wurden vor kurzem vorgelegt. Die Ergebnisse der Gutachten 5 werden mit dem Bericht VO/2016/03721 und des Gutachtens 6 mit dem Bericht VO/2016/03720 vorgestellt.
2 Ergebnisse des Gutachtens 3 „Plausibilitätsprüfung und Fortschreibung der Seever-
kehrsprognose 2030 für Lübeck“
2.1 Anlass
Für 2030 liegt eine durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Auftrag gegebene Seeverkehrsprognose vor, nach der für die Lübecker Häfen ein Anstieg des Umschlagvolumens auf insgesamt 28,0 Mio. t (netto) erwartet werden kann. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,3 %. Die Seeverkehrsprognose stammt aus dem Jahr 2013 und basiert auf den Umschlagzahlen des Basisjahres 2010.
Anhand des von der LPA beauftragten Gutachtens sollte eine bessere Einschätzungsmöglichkeit der vorliegenden Zahlen der aktuellen Seeverkehrsprognose geschaffen werden und speziell für den Hafen Lübeck eine Fortschreibung erfolgen. Mit Hilfe von Szenarien war eine Bandbreite für das zu erwartende Umschlagvolumen aufzustellen. Hierbei sind die Lübeck spezifischen Randbedingungen stärker in den Fokus gerückt und die bestehenden zukünftigen Potenziale sind benannt und in der Bewertung berücksichtigt worden. Hierzu wurden im Vorfeld diverse Grundlagengutachten zur Abschätzung der Potenziale erarbeitet und dienen u.a. als Begründung für die erzielten Ergebnisse.
Das Hauptziel der Fortschreibung der Seeverkehrsprognose für Lübeck ist es, auf Basis der aktuellen Gütermengenentwicklung und -verteilung und der zugehörigen Ladungsträgerstruktur die Entwicklung für den Hafen Lübeck bis 2030 zu prognostizieren, bestehende Marktpotenziale zu erfassen und eine nachvollziehbare Grundlage als Basis für die HEP-Bearbeitung zu erarbeiten. Bei der Aktualisierung der Seeverkehrsprognose für den Seehafen Lübeck wurden die realen Umschlagzahlen der letzten 5 Jahre von 2011 bis 2015 berücksichtigt und bewertet.
2.2 Durchführung
Die Bearbeitung erfolgte in drei Arbeitsschritten, wobei nachfolgende Punkte berücksichtigt wurden:
- Bearbeitung von Szenarien mit unterschiedlichen Wachstumszahlen der relevanten Handels- und Wirtschaftszonen.
- Einfügen von Zwischensteps - 5-Jahresschritte - in den derzeit bestehenden Betrachtungszeitraum von 2010 bis 2030.
- Einbeziehung weiterer Einflussfaktoren wie größere EU-weite Verkehrsprojekte Straße/Schiene in einvernehmlicher Abstimmung mit dem Auftraggeber.
- Abgleich der Potenzialprognose mit den vorhandenen realen Hinterlandkapazitäten (Berücksichtigung bereits geplanter Baumaßnahmen gem. Bundesverkehrswegeplan zur Verbesserung der Hinterlandanbindungen).
- Berücksichtigung der Ergebnisse und Kernaussagen der anderen Grundlagengutachten 1, 2, 4 bis 7.
- Prüfung der in der Seeverkehrsprognose 2030 berücksichtigten sog. „Megatrends" und singulären Verkehrserzeuger. Dies sind gemäß Seeverkehrsprognose 2030 wichtige Industrien wie die Mineralöl- und Chemische Industrie sowie die Bereiche Energie, Fahrzeugbau-, Kohle, Offshore Windkraft, Papier; Automobile, weitere Zukunftsmärkte etc.
- Benennung der Auswirkungen der festen Fehmarnbeltquerung (FFBQ) auf die Lübecker Schwedenverkehre.
- Szenarien mit verschiedenen Realisierungszeitpunkten für die feste FFBQ.
- Szenarien auf Basis unterschiedlicher Verkehrsaufkommensprognosen zur FFBQ.
- Umfang und Struktur von Papiertransporten sowie anderer für Lübeck wichtiger Gütergruppen.
- Erarbeitung und Benennung der zukünftigen Ladungsträgerverteilung für das Jahr 2030
Die nachfolgenden Ergebnisse stellen somit eine Grundvoraussetzung dar, um die erforderlichen hafeninfrastrukturellen Anpassungen und Veränderungen – also die Ideal- und Groblayouts der einzelnen Hafenterminals für 2030 – im Block 4 (eigentlicher Hafenentwicklungsplan) bearbeiten und zeitlich priorisieren zu können.
2.3 Ergebnisse
Obwohl weltweit ein leicht positiver Trend für den RoRo-/Fährverkehr zu erkennen ist, ist die Situation in der Branche im Ostseeraum seit mehreren Jahren stark angespannt. In den nächsten fünf Jahren wird für Nordeuropa aufgrund der Umsetzung der SECA-Regularien (Sulphur Emission Control Area) und der schwachen gesamtwirtschaftlichen Lage in der Eurozone kein bzw. nur ein sehr langsames Wachstum erwartet. Die Situation in der Ostsee wird teilweise sogar als prekär bezeichnet, beispielsweise auch vor dem Hintergrund, dass Finnland bereits die letzten drei Jahre in Folge ein negatives Wirtschaftswachstum verzeichnen musste. Auch die Russlandkrise wirkt sich zusätzlich negativ auf die Umschlagmengen von Finnland und das Baltikum (Transitverkehr mit Russland) aus.
Die Handelsbeziehungen zu Russland werden sich mittel- bis langfristig verbessern. Somit ist im Rahmen des HEP die Vorbereitung auf den zukünftigen Russlandverkehr erforderlich, da Russland langfristig ein wichtiger Markt für den Standort Lübeck wird. Bestrebungen, die Verkehre von/nach Russland auszubauen, sollten vorangetrieben werden, damit sie bei einer Entspannung der politischen Situation umgehend umgesetzt werden können.
Der Umschlag der deutschen Seehäfen hat sich insgesamt im Zeitraum 2010-2014 um 11 % bzw. um durchschnittlich 2,6 % p.a. erhöht. Gemäß der Seeverkehrsprognose 2030 sollten es durchschnittlich 2,8 % p.a. sein. Das Umschlagvolumen der deutschen Seehäfen lag 2014 insgesamt 0,5 % unter dem prognostizierten Volumen der Seeverkehrsprognose. Dabei sind allerdings die Umschlagvolumen der Nordseehäfen deutlich stärker angestiegen als die der deutschen Ostseehäfen. Infolge dieser Entwicklung lag das Umschlagvolumen der deutschen Nordseehäfen in den Jahren 2010 bis 2014 leicht über den prognostizierten Werten, während die deutschen Ostseehäfen die prognostizierten Umschlagmengen bis 2014 nicht erreichten. Im Jahr 2014 nahmen die Zuwächse der Nordseehäfen ab und näherte sich den Prognosewerten weiter an. Die Abnahme des Umschlagwachstums in den Westhäfen ist vor allem auf die abgeschwächte Konjunktur mit entsprechend rückläufigen Wachstumsraten in Asien und innerhalb Europas zurückzuführen.
Der Umschlag der deutschen Ostseehäfen lag im Jahr 2014 insgesamt um knapp 10 % unter der Prognose. Hierfür sind unter anderem die schwache konjunkturelle Entwicklung einiger Ostseeanrainerstaaten, die zunehmenden Spannungen zwischen Europa und Russland sowie veränderte Ladungsströme im Ostseeraum verantwortlich. Hier sind zum Beispiel die rückläufigen Transitaufkommen der baltischen Staaten infolge des Russland Embargos zu nennen.
Der Umschlag des Seehafens Lübeck hat sich im Zeitraum 2010-2014 von 17,8 Mio. t auf 17,2 Mio. t reduziert. Damit lag der Umschlag des Hafens Lübeck Ende 2014 um knapp 12 % bzw. um 2,4 Mio. unter dem prognostizierten Wert. Im Jahr 2015 erfolgte noch mal eine Reduzierung des Hafenumschlags um weitere 0,6 Mio. t auf 16,6 Mio. t. Dies ist sowohl auf die schwache konjunkturelle Entwicklung bei den Partnerländern als auch auf wettbewerbsbedingte Verluste von Umschlagvolumen zurückzuführen.
Ausschlaggebend für die in der Seeverkehrsprognose prognostizierten 28 Mio. t waren die gute geographische Lage sowie die gute infrastrukturelle Anbindung an das Hinterland Lübecks. Ein weiterer wichtiger Vorteil des Lübecker Hafens ist die Ausrichtung der Hinterlandverkehre auf wesentliche Wachstumsregionen in Deutschland und Europa. Aufgrund der oben genannten Entwicklungen des Außenhandels stagnierte der Umschlag des Lübecker Hafens in den Jahren 2010 bis 2015 weitgehend auf dem Niveau von 2010. Dies wirft die Frage auf, ob der in der Seeverkehrsprognose prognostizierte Umschlag von 28 Millionen t im Jahr 2030 vom Lübecker Hafen noch erreicht werden kann.
Da die Seeverkehrsprognose des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung eine Punkt zu Punkt Prognose ist, enthält sie keine Aussagen über die Entwicklung innerhalb des Prognosezeitraums. Dies bedeutet allerdings nicht, dass mögliche Abweichungen vom durchschnittlichen prognostizierten Wachstum innerhalb des Prognosezeitraums in der Seeverkehrsprognose ignoriert wurden. Neben konjunkturellen Schwankungen wurden auch Sondereffekte wie zum Beispiel erhöhte Transportkosten bei Fährverkehren aufgrund der seit 2015 geltenden SECA-Richtlinien berücksichtigt.
Ausgehend von dem realisierten Umschlagvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 16,6 Mio. t ist das prognostizierte Umschlagvolumen von 28 Mio. t in 2030 rechnerisch zu erreichen, wenn im Zeitraum 2016-2030 eine durchschnittliche Wachstumsrate von 3,5 % pro Jahr realisiert wird. Dies sind ca. 0,7 %-Punkte mehr, als bisher prognostiziert. Da auch innerhalb der Seeverkehrsprognose 2 Szenarien berücksichtigt wurden, bei denen die Wachstumsraten jeweils um 0,3 %-Punkte um den Mittelwert schwanken, ist eine durchschnittliche Wachstumsrate von 3,5 % p.a. gerade noch an der oberen Bandbreite der Seeverkehrsprognose. Im Abgleich hierzu war das durchschnittliche Wachstum im Lübecker Hafen zwischen 1996 bis 2007 bei 3,3% p.a.
Die folgende Abbildung veranschaulicht, wie sich der Umschlag des Lübecker Hafens bis 2030 entwickeln müsste, wenn er in jedem Jahr des Planungszeitraumes um den prognostizierten durchschnittlichen Prozentsatz wächst. Dem sind die in den Jahren 2010 bis 2015 tatsächlich realisierten Umschläge gegenübergestellt.

Abb. 3 – Abgleich Seeverkehrsprognose mit dem tatsächlichen Güterumschlag 2011 bis 2015 für den Lübeck Hafen
Die wichtigsten Partnerländer für den Seehafen Lübeck im Jahr 2010 sind Schweden mit einem Anteil von 52 % und Finnland mit einem Anteil 34 % am Umschlag. Mit weitem Abstand folgen Lettland und Russland mit jeweils 3 % Anteil am Hafenumschlag. Die übrigen Partnerländer haben jeweils einen Anteil von maximal einem Prozent. In dem Umschlagvolumen von Finnland und dem Baltikum sind allerdings auch die Transitmengen von und nach Russland enthalten. Aktuell nehmen die Umschlagvolumen mit Russland sowie dem Baltikum aufgrund der Sanktionen weiterhin ab.
Szenarien zur Umschlagprognose
Im Folgenden werden sechs Wachstumsszenarien für den Hafen Lübeck dargestellt. Grundlagen dieser Szenarien sind aktuelle Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung des Außenhandels der Partnerländer Lübecks von Information Handling Service (IHS) Global Inside[1] für den Zeitraum 2015 bis 2030. Darüber hinaus sind die Ergebnisse der Grundlagengutachten 1 und 2 sowie 4 bis 7 berücksichtigt.
Wesentliche neue Ergebnisse ergab das Grundlagengutachten 4 zum Papier-, Holz- und Zelluloseumschlag. Der Papierumschlag im Ostseeraum hat sich in den Jahren 2010 bis 2014 aufgrund geänderter Logistikstrukturen sowie infolge neuer Strategien der Papierindustrie insgesamt abgeschwächt. Der Papierumschlag Lübecks ist im Zeitraum 2011 bis 2014 um ca. 10 % zurückgegangen. Jüngste Entscheidungen von Papierproduzenten werden dazu führen, dass ein Teil des Aufkommens Lübecks ab den Jahren 2015 und 2016 in den Wettbewerbshäfen Kiel und Rostock umgeschlagen werden. Für den Seehafen Lübeck ist daher insgesamt von einer Abnahme des Umschlags der Gütergruppe 60 - Papier, Zellulose und Schnittholz - von 4,9 Millionen t in 2010 auf 3,2 Millionen Tonnen im Jahr 2030 auszugehen. Dieser Rückgang ist allerdings ausschließlich auf den Papierumschlag zurückzuführen. Dagegen wird der Umschlag von Zellulose und Schnittholz voraussichtlich weiter wachsen, wobei sich die Ausgangsmengen im Abgleich zum Papier auf einem niedrigen Level bewegen.
Für die Bestimmung der zukünftigen Ladungsträgerstruktur sind die Ergebnisse der Grundlagengutachten 5 und 6 bzgl. Einschätzung des kombinierten Verkehrs und bzgl. der Entwicklung des Containerumschlags von wesentlicher Bedeutung. Das Gutachten 7 liefert wichtige Informationen zu den logistischen Potenzialen in Verbindung mit dem Hafen.
Zusätzliches Potenzial für den Seehafen Lübeck wird im Rahmen des Grundlagengutachtens 6 vor allem im Handel mit Litauen und Russland erwartet. Im Rahmen von Gesprächen mit Experten über Potenziale im Ostseeraum wurden diese Potenziale größenordnungsmäßig abgeschätzt. Dieses erfolgte sinnvollerweise über entsprechende Schiffsliniendienste vergleichbar mit den bestehenden Schiffsdiensten nach Südschweden und Finnland sowie Lettland. Es wird unterstellt, dass so die Potenziale besser erhoben und ermittelt werden können, da regelmäßige Liniendienste das russische und baltische Potenzial am besten beschreiben. Diese Dienste gibt es derzeit so noch nicht und der Hafen Lübeck kann im Wettbewerb mit den anderen Ostseehäfen bis 2030 diese Dienste gewinnen. Die Potenziale bezüglich der Entwicklung der Handelsbeziehungen mit Russland und den baltischen Staaten werden in Hinblick auf die zu prognostizierenden Gütermengen die im Lübecker Hafen über die Kaikante gehen könnten, mit zusätzlichen rd. 3,3 Mio. t eingeschätzt.
Die erstellten 6 Entwicklungsszenarien für den Hafenumschlag des Lübecker Hafens unterscheiden sich im Groben hinsichtlich des jeweiligen Wirtschafts- und Handelswachstums mit den jeweiligen relevanten Handelspartnern, der Berücksichtigung einer FFBQ im Prognosezeitraum oder nicht und der Berücksichtigung der russischen und baltischen Umschlagpotenziale oder nicht. In einer Übersicht sieht das wie folgt aus:

Tab. 1 – Übersicht zu den Unterschieden in den Szenarien
Grundlagen der Szenarien sind somit unterschiedliche Annahmen zur Entwicklung des Wirtschaftswachstums und des Außenhandels der relevanten Regionen sowie vorab in Expertenrunden identifizierte Potenziale, die Lübeck im Wettbewerb mit anderen Seehäfen bis zum Jahr 2030 voraussichtlich haben kann. Die Realisierungschancen der oben genannten Potenziale von Lübeck sind aufgrund der im Vergleich zu anderen Ostseehäfen guten infrastrukturellen Anbindung sowie des relativ großen Wachstumspotenzials der Hinterlandregionen Lübecks relativ hoch. Bei den Hinterlandverkehren profitiert der Hafen Lübeck außerdem von seiner räumlichen Nähe zu wirtschaftlich starken Wachstumsregionen wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Die räumliche Nähe Lübecks zu Nordrhein-Westfalen lässt es zu, dass auf der Grundlage der vorhandenen Verkehrsanbindungen z.B. Lkw-Transporte von und nach Nordrhein-Westfalen innerhalb eines Tages unter Berücksichtigung der Lenkzeitregelungen für durchgeführt werden können.
Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor für die künftige Umschlagentwicklung des Lübecker Hafens ist die geplante sogenannte Feste Fehmarnbeltquerung (FFBQ). Wann die FFBQ realisiert und betriebsbereit sein wird, kann aus heutiger Sicht noch nicht exakt gesagt werden. Darüber hinaus sind wesentliche Verlagerungen von Verkehren auf die FFBQ erst möglich, nachdem sowohl für LKW-Transporte als auch für den Schienenverkehr die Hinterlandanbindungen in Deutschland entsprechend angepasst wurden. Beide werden voraussichtlich nicht gleichzeitig realisiert werden. Die Schieneninfrastruktur wird voraussichtlich wesentlich später angepasst werden. Die Realisierung vergleichbarer Infrastruktur-Projekte dauerte bisher in Deutschland in der Regel mindestens 10 bis 15 Jahre. Aufgrund dieser Unsicherheit in Bezug auf den Fertigstellungstermin der FFBQ und der notwendigen Hinterlandanbindungen werden alle Szenarien jeweils mit und ohne FFBQ gerechnet. Bei den Varianten mit FFBQ wird von einer regelmäßigen Betriebsaufnahme der FBBQ ab 2026 ausgegangen. Ab diesem Zeitpunkt werden ca. 20 % von Verkehren mit Schweden, die ansonsten Potenzial des Lübecker Hafens wären, auf die FFBQ verlagert.
Wesentliche Verlagerungseffekte infolge der SECA-Richtlinien werden für den Hafen Lübeck bis 2030 nicht erwartet. Die aktuellen sehr niedrigen Ölpreise haben dazu geführt, dass die vorhergesagten Kostensteigerungen für schwefelarme Treibstoffe infolge der neuen Umweltvorschriften bisher nicht eintraten. SECA führt zwar zunächst zu einer Erhöhung der Investitionen und/ oder Betriebskosten im Fährverkehr, dieser zusätzliche Aufwand wird aber am Ende des Planungszeitraumes 2030 voraussichtlich nicht mehr relevant sein, da auch die anderen Verkehrsträger Schiene und Straße ebenfalls neue Umweltauflagen erfüllen müssen und somit Verlagerungseffekte zu Lasten der Schifffahrt langfristig nicht zu erwarten sind.
Die Prognose für das Wachstum des Außenhandels mit Russland und den baltischen Staaten basieren auf der Annahme, dass sich die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Westeuropa und Russland in den Jahren 2017 bis 2019 wieder stabilisieren und das Embargo zunächst gelockert und bis Ende 2019 weitgehend aufgehoben ist. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Wachstumspotenziale des Außenhandels mit diesen Ländern realisiert werden können. Das Embargo mit Russland hat zu einem deutlichen Rückgang der Handelsbeziehungen sowohl mit Russland als auch mit den baltischen Staaten geführt. Bei den baltischen Staaten haben sich die Transitmengen nach Russland infolge des Embargos deutlich reduziert. Außerdem ist der direkte Handel zwischen den baltischen Staaten und Russland erheblich zurückgegangen. In den Szenarien wird davon ausgegangen, dass sich mit Aufhebung des Embargos auch die wirtschaftlichen Beziehungen zu den baltischen Staaten und Russland wieder normalisieren.
Insgesamt ergeben die Szenarien ein Umschlagspektrum von 22,4 Millionen t in Szenario 6 „Worst Case“ bis zu 33,3 Millionen t im „Best Case“ in Szenario 1. Die Szenarien 3 und 4 lassen sich als die Basisprognose bezeichnen, weil diese mit der Seeverkehrsprognose hinsichtlich der angesetzten Wachstumsraten vergleichbar sind. Das optimistische Szenario 1 geht davon aus, dass die FFBQ bis 2030 – also innerhalb des Prognosezeitraums - nicht realisiert wird, alle Umschlagpotenziale mit Russland und dem Baltikum über den Hafen Lübeck bis 2030 aktiviert werden können und der Außenhandel stärker als in der Basisprognose (um 25 %) vorgesehen wächst. Szenario 6 basiert auf einem abgeschwächten Wirtschaftswachstum und der Realisierung der FFBQ im Zeitraum 2025-2030. Die russischen und baltischen Potenziale sind in diesem Szenario nicht vorgesehen. In der Tabelle 2 werden die zukünftigen Umschlagmengen/-potenziale dargestellt.

Tab. 2 – Übersicht über die prognostizierten Umschlagmengen/-potenziale der Szenarien

Abb. 4 – Szenarien bezüglich der neuen Umschlagsprognose für den Hafen Lübeck
Insgesamt ist festzustellen, dass ein signifikanter Anstieg der Anteile der baltischen Staaten sowie Russlands am Umschlag des Lübecker Hafens nur dann eintreten wird, wenn zusätzliche Dienste mit diesen Staaten realisiert werden bzw. im Wettbewerb mit den anderen Häfen gewonnen werden können. Dieses Potenzial wurde in den Szenarien 1, 3 und 5 berücksichtigt.
3 Fazit und Empfehlungen
Als Empfehlung für die Bearbeitung des Blocks 4 zum Hafenentwicklungsplan schlägt der Gutachter vor, die Basisszenarien 3 und 4 zu Grunde zu legen. Das bedeutet für den Lübecker Hafen eine Umschlagentwicklung bis 2030 zwischen 23,9 Mio. t bis 29,6 Mio. t. Als Begründung sind hierfür anzuführen:
- Der Hafen Lübeck hat das Know-how und die Kapazität;
- Der Hafen Lübeck wird die derzeit bestehenden Wettbewerbsnachteile z.B. zu hohe Umschlag- und Lagerkosten und die Streikanfälligkeit reduzieren bzw. beheben;
- Der Lübecker Hafen wird sich über den HEP neu strukturieren;
- Das Wachstum innerhalb der Eurozone wird nicht stärker wachsen als in den Szenarien 3 und 4;
- Der Hafen Lübeck sich auf den Wachstumsmarkt Russland/Baltikum rechtzeitig vorbereiten wird.
4 Nächste Schritte beim HEP2030
- Kenntnisnahme und Diskussion der Ergebnisse der übrigen Grundlagengutachten.
- Übernahme aller bis dahin vorhandenen Ergebnisse in den Block 4.
- Bearbeitung Block 3 läuft seit 1. Quartal 2015.
- HEP-Bearbeitung im Block 4 läuft seit 1. Quartal 2016.
[1] Vgl. IHS Global Inside; World Trade Service
Anlagen
Kurzfassung des Gutachtens 3
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
| 1 | öffentlich | Anlage 1_Kurzbericht Gutachten 3 (1309 KB) | |||