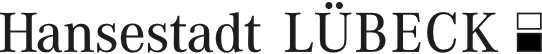- Bürgerservice
- Rathaus
Rathaus
- Rathaus
- Karriereportal
- Politik
- Verwaltung
- Verwaltung
- Antidiskriminierung bei der Hansestadt Lübeck
- Bürgermeisterkanzlei
- Büro der Bürgerschaft
- Feuerwehr
- Finanzen
- Frauenbüro
- Friedhöfe
- Gebäudemanagement
- Gesundheitsamt
- Gesundheitsamt
- Infektionsschutz und Hygiene
- Infektionsschutz und Hygiene
- Übertragbare Krankheiten
- Fragen und Antworten (FAQ)
- Hygieneüberwachung
- Tuberkuloseberatung
- Impfungen
- Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- Zahnärztlicher Dienst
- Amtsärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit
- Weitere Aufgaben
- Ihre Meinung zählt
- Tag der seelischen Gesundheit
- Konzernstruktur
- Kurbetrieb Travemünde
- Lübeck Port Authority
- Ordnungsamt
- Recht
- Soziale Sicherung
- Stabsstelle Migration und Ehrenamt
- Stadtgrün und Verkehr
- Stadtplanung und Bauordnung
- Stadtteilkonferenzen
- Stadtwald
- Standesamt
- Statistik
- Stiftungsverwaltung
- Straßenverkehrsbehörde
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Naturschutz
- Naturschutz
- Schutzgebiete
- Schutzgebiete
- Naturdenkmale flächenhaft
- Naturdenkmale objektbezogen
- Naturdenkmale objektbezogen
- Hängebuche in der Gärtnergasse
- Silberlinde am Koberg
- Ginkgo am Lindenplatz
- Bäume auf dem Jerusalemsberg
- Platanen auf dem Burgtorfriedhof
- Eichen am Waldsaum
- Lindenallee zum Gut Strecknitz
- Eichen- und Lindenallee in Padelügge
- Eichen vor der Schule in Niendorf
- Eichen auf dem Jahnplatz
- Natura 2000-Gebiete
- Geschützte Landschaftsbestandteile
- Naturschutzgebiete
- Landschaftsschutzgebiete
- Arten- und Biotopschutz
- Landschaftsplanung
- Erholung und Natur
- Projekte
- Klima
- Wasser
- Abfall
- Boden
- Lebensmittelüberwachung
- Veterinärwesen
- Gesundheitlicher Umweltschutz
- Hilfe in Notlagen
- Wirtschaft und Liegenschaften
- Wohnraum für Studierende
- Lübeck international
- Stadtleben
Stadtleben
- Stadtleben
- Familie und Bildung
- Familie und Bildung
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Stillfreundliche Stadt
- Beratung und Bildung
- Beratung und Bildung
- Beratung in der Schwangerschaft
- Willkommensbesuche
- Beratungsstellen Frühe Hilfen
- Familienzentren
- Familienzentren
- Familienzentrum / Kita Brüder-Grimm-Ring
- Familienzentrum / Kita Familienkiste
- Familienzentrum / Kita Schaluppenweg
- Familienzentrum / Kita Willy Brandt
- Familienzentrum / Kita St. Bonifatius
- AWO-Familienzentrum / Kita Redderkoppel
- Familienzentrum / Kinderhaus Pellwormstraße
- Familienzentrum / Kita Behaimring
- Familienzentrum / Kita Dreifaltigkeit
- Familienzentrum / Kita Helene Bresslau
- Familienzentrum / Kita Haus Barbara
- AWO-Familienzentrum / Kita Drachennest III
- Familienzentrum / Kita Kinderstube - Travemünde
- Familienzentrum / Kita Sprungtuch e.V. BunteKuh
- Familienzentrum / Kita Beim Meilenstein
- Familienzentrum Kinderhaus Alsheide
- Familienzentrum / Kinderclub
- Familienwegweiser
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen Jugendamt
- Familienbildung
- Telefon-Hotlines
- Beratungsstellen für Familien
- Kindertagesbetreuung
- Jugendamt
- Finanzielle Unterstützung
- Elterngeld/Kindergeld
- Freizeit
- Kinder von 3 - 6
- Kinder von 6 - 12
- Kinder von 6 - 12
- Schule
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Beratung und Unterstützung
- Beratung und Unterstützung
- Finanzielle Unterstützung
- Hilfe und Tipps für Kinder und Jugendliche
- Beratungsstellen für Familien
- Schulpsychologische Beratungsstelle
- Schulsozialarbeit
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen des Jugendamtes
- Telefon-Hotlines
- Familienservice
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Jugendamt
- Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Jugendliche
- Jugendliche
- Schule
- Schule und dann?
- Berufsausbildung
- Studium
- Jugendarbeit
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Jugendamt
- Beratung und Unterstützung
- Kinder- und Jugendbeteiligung
- Weitere Angebote
- Kinder- und Jugendschutz
- Sport
- Erwachsene
- Bildungsplanung
- Tourismus
- Tourismus
- Lübeck
- Travemünde
- Travemünde
- 200 Jahre Ostseebad
- Schiffe gucken
- Sehenswertes in Travemünde
- Strandleben
- Stadtplan Travemünde
- Travemünder Woche
- Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr
- Freizeit
- Freizeit
- LübeckCard
- Mobilität
- Lübecker Schwimmbäder
- Natur erleben
- Grünanlagen und Spielplätze
- Grünanlagen und Spielplätze
- Stadteingänge
- Patenschaften
- Private Feiern im öffentlichen Grün
- Grillen in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Baum des Jahres
- Baum des Jahres
- Stiel-Eiche
- Rot-Buche
- Sommer-Linde
- Berg-Ulme
- Speierling
- Gewöhnliche Eibe
- Spitz-Ahorn
- Hainbuche
- Eberesche
- Wild-Birne
- Silber-Weide
- Sandbirke
- Gewöhnliche Esche
- Gewöhnlicher Wacholder
- Schwarz-Erle
- Weiß-Tanne
- Rosskastanie
- Schwarz-Pappel
- Wald-Kiefer
- Walnuss
- Berg-Ahorn
- Vogel-Kirsche
- Elsbeere
- Europäische Lärche
- Wild-Apfel
- Trauben-Eiche
- Feld-Ahorn
- Winter-Linde
- Fichte
- Esskastanie
- Flatterulme
- Robinie
- Stechpalme
- Rot-Buche
- Moor-Birke
- Mehlbeere
- Roteiche
- Karte Baum des Jahres
- Schnullerbaum
- Baumkataster
- Klimabäume
- Baumspende
- Habitatbäume
- Anders parken – Bäume schützen
- Grün- und Parkanlagen
- Stadtnahe Erholung
- Spielen in der Stadt
- Sport
- Wochenmärkte
- Weihnachtsmärkte
- Schwimm- und Badegewässer
- Laternenumzug
- Kultur
- Kultur
- Museen
- Museen
- Museum Holstentor
- Buddenbrookhaus
- Günter Grass-Haus
- Kunsthalle St. Annen
- Museum Behnhaus Drägerhaus
- Willy-Brandt-Haus
- Museum für Natur und Umwelt
- KOLK 17 Figurentheater & Museum
- Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk
- Grenzmuseum
- Europäisches Hansemuseum
- Katharinenkirche
- St. Annen-Museum
- Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck
- Niederegger Marzipansalon
- Museum Alter Leuchtturm Travemünde
- Overbeck-Gesellschaft
- Museum Haus Hansestadt Danzig
- Theater
- Musik- & Kongresshalle
- Schleswig-Holstein Musik Festival
- Nordische Filmtage Lübeck
- Musikhochschule
- Bibliothek der Hansestadt Lübeck
- Stadtarchiv
- Kulturbüro
- Historische Pflaster
- Archäologie und Denkmalpflege
- Stolpersteine
- Galerien
- Filmstadt Lübeck
- Gedenkstätte Lübecker Märtyrer
- Wissenschaftspfad
- Kolosseum Lübeck
- Wohnen in Lübeck
- Veranstaltungen
- Stadtentwicklung
Stadtentwicklung
- Stadtentwicklung
- Lärmschutz
- Radverkehr
- Klima
- Klima
- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel
- Nachhaltigkeit
- Klimafonds
- Smart City Lübeck
- Smart City Lübeck
- Smart City Family
- Projekte und Maßnahmen
- Wir digital für Lübeck
- Digitale Strategie
- Smart City Infrastruktur
- Beteiligung
- überMORGEN
- überMORGEN
- Stadtentwicklungsdialog
- Rahmenplan und Mobilitätskonzept Innenstadt
- Verkehrsentwicklungsplan
- Stadtteilveranstaltungen
- Flächennutzungsplan
- Radverkehrskonzept
- Hafenentwicklungsplan
- Touristisches Entwicklungskonzept
- Kommunales Integrationskonzept
- Umfrage Klimaschutzmaßnahmen für 2021
- Masterplan Klimaschutz
- Übergangsweise
- Wirtschaftsförderung
- Priwall-Promenade
- Stadtplanung
- Stadtplanung
- Einzelhandelskonzepte
- Gewerbeflächen
- Wohnungsmarktberichte
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Verkehrskonzepte / ÖPNV
- Lübeck 2030
- Aktuelle Wohnbauprojekte
- Wohnquartier Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld
- Gründungsviertel
- Bauleitplanung
- Städtebauförderung
- Infrastruktur
- Stadtbildpflege
- Verkehrsmanagementsystem
- Hafen Lübeck
- Sportentwicklung
- Fehmarnbeltquerung
- Presse
Vorlage - VO/2016/03721
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag
Die Ergebnisse eines weiteren Gutachtens zur Aufstellung eines neuen Hafenentwicklungsplans (HEP) bis 2030 liegen vor und werden in diesem Bericht zusammengefasst. Es handelt sich hierbei um das Gutachten „Wachstumspotenzial schienengebundener Verkehre“ (Gutachten 5).
Begründung
1 Allgemeines
Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hat am 28.11.2013 unter TOP 10.6 (VO/2013/00904) den Bürgermeister beauftragt, für den Prognosezeitraum bis 2030 einen neuen Hafenentwicklungsplan (HEP) aufzustellen. Die LPA hat hierzu eine Grundstruktur für die Bearbeitung des Hafenentwicklungsplans 2030 aufgestellt. Demnach werden gem. den nachfolgenden Schaubildern im Block 2 die Grundlagendaten vor der eigentlichen Bearbeitung des Hafenentwicklungsplans im Block 4 erhoben. Die Ergebnisse des Gutachtens 4 liegen mittlerweile vor und werden in diesem Bericht zusammengefasst.

Abb. 1 – Grundstruktur HEP2030

Abb. 2 – Grundstruktur Block 2 HEP2030
Die Ergebnisse der Gutachten 1 und 2 wurden bereits mit Bericht vom 01.06.2015 (VO/2015/02673) der Bürgerschaft vorgestellt. Die Ergebnisse des Gutachtens 7 (VO/2016/03552) und des Gutachtens 4 (VO/2016/03550) wurden vor kurzem vorgelegt. Die Ergebnisse des Gutachtens 6 werden mit dem Bericht VO/2016/03720 und des Gutachtens 3 mit dem Bericht VO/2016/03722 vorgestellt.
2 Ergebnisse zum Gutachten 5 „Wachstumspotenziale schienengebundener Verkehre“
2.1 Anlass
Aufgabe des Gutachtens 5 ist es, die Wachstumspotenziale schienengebundener Verkehre zu bewerten und diese mit der vorhandenen Hafenbahninfrastruktur und den zugehörigen Hinterlandverbindungen Schiene abzugleichen. Dabei geht es vor allem auch darum, Kapazitätsengpässe zu identifizieren und infrastrukturelle Maßnahmen zu benennen, die diese Kapazitätsengpässe minimieren oder beseitigen. Bei der Kapazitätsbetrachtung ist einmal eine vollfunktionstüchtige feste Fehmarnbeltquerung (FFBQ) als ein Szenario mit zu betrachten.
Grundsätzliche Leitlinie des Lübecker Hafens ist hierbei, den modal split zugunsten des Bahnanteils zu verschieben, um unsere Autobahnen vor dem zukünftigen Verkehrskollaps zu bewahren und um Emissionen zu minimieren. Hierbei ist es noch wichtig zu wissen, dass 80% der Lübecker Hafenumschlagverkehre Hinterlandverkehre sind.
Bei der Betrachtung muss zwischen den verschiedenen Bahnverkehren unterschieden werden. Hier gibt es den Schienenpersonen-Fernverkehr (SPFV), den Schienenpersonen-Nahverkehr (SPNV) und den Schienengüterverkehr (SGV), der sich noch mal in den konventionellen Schienengüterverkehr und den Kombinierten Verkehr (KV) untergliedert.
Der konventionelle Schienengüterverkehr (Ganzzugverkehr oder Einzelwagenverkehr) ist im Gegensatz zum Kombiverkehr in der Regel ein ungebrochener Verkehr, das heißt er findet organisatorisch als Direktverkehr statt, bei dem es keinen Vor- oder Nachlauf über einen anderen Verkehrsträger gibt und bei dem keine Umsteige- oder Weiterleitungsverkehre stattfinden. Mehrgliedrige Rangier- und Umgruppierungsprozesse innerhalb des Verkehrsträgers Schiene sind jedoch möglich und abhängig von der Angebotsform des konventionellen Schienengüterverkehrs. Üblicherweise ist der konventionelle Schienengüterverkehr ein Punkt-zu-Punkt-Verkehr.
Kombinierter Verkehr (kurz KV) bezieht sich auf den Transport von Gütern in LKW-Trailern, Containern oder Wechselbrücken. Prinzipiell geht es darum, die Vorteile der verschiedenen Verkehrsträger zu kombinieren. Sinn und Zweck ist es, z.B. die Strecken, die per LKW - also per Straße - zurückgelegt werden, sinnvoll zu verringern und die Hauptstrecken mit Hilfe der Bahn und des Schiffes zurückzulegen. In der Regel werden im Einzugsgebiet der Lübeck-relevanten KV-Stationen/KV-Terminals (von Kranen überspannte Gleise wie z.B. Ludwigshafen, Duisburg, Mannheim, Verona, Basel etc.) Güter auf die Bahn verladen, nach Lübeck zum dortigen KV-Terminal gefahren und mittels Kran wieder abgeladen. Hier werden sie als RoRo-Einheit in die Fähren geschoben, zum skandinavischen Zielhafen gefahren und dann auf der Straße oder per Bahn zum Zielort weitertransportiert. Umgekehrt kommen Einheiten per Schiff aus Schweden und Finnland im Lübecker Hafen an, werden im KV-Terminal auf die Bahn verladen und zu den relevanten KV-Stationen gefahren. Diese Art des Verkehrs trägt dazu bei, unsere Autobahnen vom LKW-Verkehr zu entlasten und unsere Umwelt zu schonen. Wichtig für diese Art des Transports ist, dass hochfrequentierte Fährabfahrten und Shuttlezugverbindungen bestehen, um kundenflexibel und insgesamt für eine möglichst große Anzahl von Einheiten attraktiv zu sein. Beides ist für den Lübecker Hafen der Fall.
2.2 Ergebnisse
Mit Hilfe von Expertengesprächen und den in der Branche diskutierten Trends wurden die zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen für diese Untersuchung im Vorfeld festgelegt.
Für die schienengebundenen Verkehre werden Ganzzuglängen von 750 m zur Beurteilung der Netzkapazitäten für den SGV festgesetzt (siehe auch Gutachten 1).
Wichtigster Terminal für Bahnver- und -entladung ist der Skandinavienkai. Durch den Kombiverkehr bestehen gute Möglichkeiten, den modal split zugunsten der Schiene zu verschieben. Zusammenfassend kann somit für die Schiene als Wettbewerbsfaktor für den Lübecker Hafen festgestellt werden, dass der Standort Lübeck sowohl bezüglich eines diversifizierten Wettbewerbs durch eine breite Angebotsstruktur mit vier KV-Operateuren als auch durch hohe Bedienfrequenzen (tägliche Abfahrten) das insgesamt beste KV-Angebot im Vergleich der drei Hafenstandorte Lübeck, Rostock, Kiel vorweist. In diesem Marktsegment besteht deutliches Wachstumspotenzial, wenn die hohe Frequenz der Fährabfahrten und –destinationen erhalten bleibt bzw. ausgebaut werden kann.
Gemäß Seeverkehrsprognose 2030 ist eine Verlagerung von Mengen aller Gütergruppen (Ausnahme: Massengut) aus Kiel, Lübeck und Rostock auf den FFBQ-Korridor zu erwarten. Eine weiterführende Quantifizierung erfolgt im Zuge der Prognose nicht. Mit Blick auf die bestehenden Güterarten im konventionellen Verkehr gehen die Gutachter davon aus, dass durch die FFBQ keine Verlagerungen eintreten, die die Bahnvolumina im Vor-/Nachlauf des Lübecker Hafens nennenswert tangieren. Losgelöst von der beschriebenen hafenbezogenen Mengen-Verlagerungsthematik lassen die Prognosen zur Entwicklung des Schienenverkehrs für den Korridor (Hamburg-)Lübeck-Puttgarden einen deutlichen Zuwachs der Zugzahlen erwarten. Wesentlicher Treiber hierfür wird vor allem der Güterverkehr mit bis zu 78 zusätzlichen Zügen pro Tag sein. Diese tangieren nicht nur den Abschnitt Lübeck-Puttgarden sondern führen konsequenterweise auch zu einer zusätzlichen Verkehrsbelastung auf dem Abschnitt Hamburg-Lübeck sowie im Knoten Hamburg. Ungeachtet der geplanten Ausbauvorhaben (z. B. möglicher Neubau der S4 zwischen Hamburg und Ahrensburg) entstehen hierdurch Rückwirkungen für den Lübecker Hafen in Folge von ggf. (wachstumshemmenden) Kapazitätsbeschränkungen sowie einer geringeren Flexibilität bei der Trassenverfügbarkeit.
Ausgehend von den FFBQ-Prognosen war zu untersuchen, ob aus der Verlagerung von Verkehrsmengen vom Jütland- auf den Fehmarnbelt-Korridor ggf. Veränderungen in der Angebotsstruktur im Schienengüterverkehr resultieren könnten, die sich vorteilhaft auf den Standort Lübeck bzw. den Lübecker Hafen auswirken würden. Während der Standort Lübeck im Schienengüterverkehr heute eher eine „Randlage“ im deutschen Netz einnimmt, liegt er nach der Eröffnung der FFBQ direkt an einer der wichtigsten europäischen Nord-Süd-Achsen. Möglichkeiten, auf dem Korridor verkehrende Züge zukünftig stärker an den Standort Lübeck zu binden, ggf. in Lübeck zu teilen, zu konsolidieren oder neu zu bilden und so für Lübeck eine Angebotsverbesserung in Form von mehr Zielen oder häufigeren Abfahrten herbeizuführen, werden aus wirtschaftlichen Beweggründen von den Gutachtern als eher limitiert angesehen.
Etwas anders stellt sich die Situation im Kombinierten Verkehr (KV) dar, wo Umsteige- bzw. Weiterleitungsverkehre nicht unüblich sind. Diese kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn z.B. das Quelle-Ziel-Aufkommen nicht ausreicht, um eine regelmäßig wirtschaftliche Auslastung eines Blockzuges zu gewährleisten.
Bezogen auf den Standort Lübeck und das Thema FBQ würde dies bedeuten, dass
a) Zuggruppen in Lübeck zusammengeführt werden (ggf. lokale Mengen mit dänischer Ladung).
b) Wagengruppen auf dem Weg von/nach Skandinavien in Lübeck an- oder abgehängt werden.
c) Züge zu unterschiedlichen mittelgroßen Zieldestinationen in Skandinavien bzw. Zentraleuropa in Lübeck neu gruppiert werden.
d) Ladungseinheiten in Lübeck auf andere Züge „umsteigen“ oder bei einem Zwischenhalt in Lübeck gelöscht bzw. geladen werden.
Während die Produktionssysteme a) bis c) lediglich Rangierkapazitäten erfordern und ausschließlich lokale Mengen zusätzliche Terminalressourcen beanspruchen, werden in einem Gateway-System d) umfangreiche Terminalkapazitäten benötigt.
Auch wenn es für eine Bewertung der Marktanforderungen und -spezifika weit vor der geplanten Eröffnung der FFBQ noch zu früh ist, kann unter Berücksichtigung der zuvor getroffenen Aussagen zur Wirtschaftlichkeit im Schienengüterverkehr davon ausgegangen werden, dass die Produktionssysteme a) bis c) aus den o. g. Gründen (Kosten, Zeitverluste) für Lübeck nur in Einzelfällen Bedeutung erlangen dürften. Für ein Bahn-Gateway-Terminal d) sollten zum einen hohe lokale Aufkommen vorhanden sein und zum anderen eine derartig vorteilhafte Lage im Netz vorliegen, dass eine effiziente Integration von nationalen und internationalen Relationen sichergestellt ist. Hierzu müssen die Transportentfernungen zu den jeweiligen Korrespondenzstandorten so groß sein, dass eine kosten- und zeitbezogen wettbewerbsfähige KV-Leistung dargestellt werden kann. Diese Anforderungen scheinen mit Blick auf Lübeck prinzipiell erfüllt. Somit könnten nach Eröffnung der festen Querung KV-Züge aus Dänemark oder Schweden den Standort Lübeck als Gateway für Zentral- und Südeuropa nutzen, sofern es gelingt, bestehende Volumina intelligent zu bündeln. Grundvoraussetzung hierfür bildet neben verfügbaren Umschlagkapazitäten ein schnelles Handling und eine geringe „Deviation“ vom Korridor. Weiterhin spielen Aspekte wie Pünktlichkeit und Einbindung der Verlader/Spediteure hierbei eine wichtige Rolle. Da das lokale Aufkommen als überschaubar bezeichnet werden kann, weil für eine Steigerung die Ansiedlung von entsprechenden Industriebetrieben erforderlich ist und das Brechen von u.a. Bahnverkehren ohne wirtschaftlich begründete Motive unwahrscheinlich erscheint, ergeben sich derzeit keine belastbaren Erkenntnisse, dass ein Bahn-Gateway-Terminal neben dem Hafen nennenswerte Potenziale hat. Diese eher defensiven Aussagen stehen teilweise im Widerspruch zu den Aussagen von Prof. Dr. Stuwe. In seiner Veröffentlichung „FehmarnBeltQuerung – Entwicklungsschub für die intermodalen Verkehre via Lübeck“ geht er von nicht unerheblichen Bündelungspotenzialen aus, ohne diese weiterführend zu quantifizieren. Es ist eher davon auszugehen, dass durch die FFBQ KV-Mengen verloren gehen, da zu einem Großteil die KV-Mengen die jetzt von und nach Südschweden gehen, zum betreffenden Zeitpunkt durch Direktzüge von und nach Südschweden neben der sog. Jütlandroute über die FFBQ ersetzt werden könnten.
Beurteilung der Bahnkapazitäten im Hinterland
Problem Knoten Lübeck
Die Leistungsfähigkeit des Knotens Lübeck wird (wie bei anderen Bahnknoten auch) maßgeblich durch den Mix aus SPFV, SPNV und SGV determiniert. Eine Verdichtung des SPNV auf drei Linien von/zum Knoten Lübeck würde dabei eine erhebliche Mehrbelastung des Knotens bedeuten. Darüber hinaus würde sich das kapazitive Verhalten des Knotens Lübeck mit der Aufnahme von Verkehren im SGV auf der Vogelfluglinie signifikant verändern. In welchem Umfang dies zu möglichen Einschränkungen auf den Knoten Lübeck und damit auch auf die Hinterlandverkehre des Lübecker Hafens führen wird, ist bislang nur schwer abzuschätzen, da ein auf dem Status quo basierendes umfassendes Kapazitätsbild für den Knoten Lübeck derzeit nicht existiert. Nach heutiger Einschätzung wird eine deutliche Ausweitung des SPNV-Angebots bei gleichzeitig signifikanten Zuwächsen im SGV aller Voraussicht zu erheblichen Rückwirkungen auf den Knoten Lübeck führen. Hieraus ergeben sich gleichermaßen Einschränkungen für die Umschlagstellen im Lübecker Hafen, deren Zu- und Ablaufstrecken von einer Taktverdichtung betroffen sind. Dies gilt prinzipiell für alle Ladestellen, besondere Auswirkungen dürften sich aber für die Ladestellen nördlich des Lübecker Hauptbahnhofs ergeben (SLK, CTL, LK, Skandinavienkai).
Strecke Lübeck-Hamburg
Auf dem weiteren Abschnitt Richtung Süden planen die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein den Bau einer eigenen S-Bahninfrastruktur auf der Relation Hamburg Hbf. – Ahrensburg – Bargteheide parallel zur bestehenden Strecke 1120 Lübeck – Hamburg. Auf diesen Gleisen soll eine neue S-Bahnlinie 4 zwischen Hamburg-Altona – Hamburg Hbf. – Bargteheide verkehren, um die diversen hier fahrenden Verkehre zu entzerren und um so mehr Kapazität auf der Fernstrecke zu schaffen.
Problem Knoten Hamburg
Der Knoten Hamburg ist aus eisenbahntechnischer Sicht einer der hoch frequentierten Bahnverkehrskontenpunkte in Europa. Der Hamburger Hauptbahnhof befindet sich durch die starken Zuwächse im SPNV gleichfalls an der Kapazitätsgrenze. Die aktuellen offiziellen Prognosen sagen dem Schienengüterverkehr bis 2030 eine deutliche Ausweitung voraus. Angesichts der bereits heute sichtbaren Kapazitätsenge im Knoten Hamburg stellt sich ernsthaft die Frage nach der ganz- oder teilweisen Realisierbarkeit solcher Zukunftswerte. Bisherige Überlegungen gehen dahin, eine weitere Verdichtung der Verkehre im Netz herbeizuführen, in dem heutige Magistralen auch das Wachstum von morgen aufnehmen sollen. Dies erscheint a) vor dem Hintergrund heutiger beschränkter Kapazitäten im Bestandsnetz nicht möglich und b) aus strategischen Überlegungen nicht zielführend; leistungsfähige Alternativrouten sind allein schon aus Gründen der Havariefolgen-Prävention angezeigt. Weitere Zuwächse dürften die betriebliche Qualität noch weiter herabsetzen. Dem gegenüber steht der Anspruch der Betreiber, der SGV müsse pünktlicher werden. Um dies zu erreichen, bedürfte es neuer Kapazitäten, um den Auslastungsgrad des Netzes abzusenken. Die derzeit geplanten Maßnahmen im südlichen Bereich des Knoten Hamburgs kommen nur den hafenbezogenen Bahnverkehren des Hamburger Hafens zu gute.
Im Bahnnetz südlich von Hamburg wird die sogenannte Alpha-Variante zur Optimierung weiterverfolgt. Diese kommt bezüglich des Güterverkehrs den betreffenden Nordseehäfen zu Gute und stellt eigentlich nur eine Übergangslösung dar. Für Lübeck hat sie keinen positiven Effekt, da weder der Knoten Hamburg entlastet wird, noch freie Kapazitäten für die Lübecker Verkehre geschaffen werden.
2.3 Fazit
Wachstum konventioneller Schienenverkehr
Anders als im KV zeigt sich im Bereich des konventionellen Verkehrs eine eher unbestimmte Entwicklung. Durch die starke Spezialisierung auf den in Lübeck zuletzt „schwierigen“ Bereich der Papier- und Forstprodukte ist die Entwicklung schienengebundener konventioneller Verkehr eher zurückhaltend zu bewerten. Als positives Szenario ist eine Wachstumsrate von 1,1% p.a. anzusetzen. Nichtsdestotrotz sind die Potenziale in den Geschäftsfeldern Autos und Stückgut sowie Massengut infrastrukturell im HEP zu berücksichtigen. Um in diesen Geschäftsfeldern die Potenziale aktivieren zu können bedarf es am Skandinavienkai eine räumliche Trennung dieser Geschäftsfelder vom KV-Verkehr.
Wachstum KV
Die KV-Prognose sagt im Entwicklungsszenario eine Umschlagmenge in Einheiten für 2030 von 178.587 bis 196.277 voraus. Als Mittelwert ergeben sich rund 187.500 Einheiten. Im Jahr 2014 und 2015 waren es im Vergleich 88.177 bzw. 97.500 Einheiten. Das entspricht einer Steigerung von rd. 100%. Bei dieser Prognose bzw. Aussicht kann die FFBQ jedoch einen einschneidenden Effekt haben, der derzeit nicht abschließend eingeschätzt werden kann. Jedoch ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Grundauslastung der KV-Züge auf vielen Relationen vor allem durch KV-Mengen aus dem Schweden-Verkehr generiert wird. Werden diese Mengen in größerem Umfang auf den Landweg verlagert, kann es passieren, dass ganze Relationen in Folge unzureichender Auslastung gestrichen oder zumindest ausgedünnt werden, so dass eine Art „Multiplikatorwirkung“ einsetzen kann. Demgegenüber stehen bis 2025 mögliche Wachstumseffekte in anderen Fahrtgebieten (z. B. Baltikum, ggf. Russland), die zu einer teilweisen Kompensation der Verluste im Südschwedenverkehr beitragen können.
Das Entwicklungsszenario „stufenweiser Ausbau“ der bestehenden KV-Anlage am Skandinavienkai ist in Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer zukünftigen Trennung der Geschäftsfelder KV und konventioneller Automobil- und Projektladungsumschlag zu sehen. Mit der baulichen Optimierung der bestehenden KV-Anlage (Gleisverlängerung um 150 m, 3. Kran, Erweiterung der Stellflächen etc.) sowie betrieblicher Optimierungen z.B. durch eine Kapazitätserhöhung im Betriebsbahnhof Skandinavienkai (Bau von drei zuglangen Gleisen) ist die gemittelte KV-Prognose abbildbar. Die beiden letztgenannten Ladungssegmente sollen ebenfalls weiter ausgebaut werden. Aufgrund der bestehenden Flächenkonkurrenz sowie unzureichender Infrastrukturkapazitäten im Bereich Schiene sehen die Berater hier konkreten Handlungsbedarf. Eine mögliche Alternative bildet die Verlagerung des Automobil- und Projektladungsumschlags zu einem zukünftigen Nordbahnhof. Inwieweit langfristig ein Bedarf für die infrastrukturelle Entwicklung des Nordbahnhofs entstehen kann, ist insbesondere von der terminalstrategischen Ausrichtung der LHG abhängig. Entscheidende Fragen hierbei sind unter anderem, wie sich das Pkw-Geschäft am Skandinavienkai entwickelt. Dementsprechend wird empfohlen, die Frage nach einem langfristigen Entwicklungsbedarf des Nordbahnhofs und damit einhergehend den Bedarf einer planerischen Vorhaltung von Flächen hierfür im Rahmen der HEP-Bearbeitung (Block 4) weiterführend zu thematisieren.
Derzeit findet auch im Bereich des Terminals CTL KV-Umschlag mit mobilen Geräten statt (3 Ganzzüge pro Woche). In Zukunft werden hier auch weitere KV-Umschlagspotenziale gesehen, die direkt mit dem erwarteten Wachstum um Short Sea Container Umschlag in Zusammenhang stehen. An diesem Standort ist derzeit keine Möglichkeit vorhanden, Ganzzüge ohne Trenn- und Rangieraufwand aufgrund der nur geringen Gleislängen von rd. 250 m abzufertigen. Ganzzuglange Terminalgleise sind somit zukünftig erforderlich, um sich in diesem Bereich entwickeln zu können.
Die Erweiterung des Betriebsbahnhofs Skandinavienkai bewirkt neben den Vorteilen für den konventionellen Bahnumschlag auch betriebliche Vorteile für den KV-Umschlag
Netzauslastung Hafenbahn/Netzauslastung Hinterland
Aufgrund der zu befürchtenden Netzbelastungen wäre für den Lübecker Hafen und dessen Bahnverkehre eine wettbewerbsfähige zweite Elbquerung und die Vermeidung der Durchfahrung des Hamburger Knotens sehr sinnvoll. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des Bundesverkehrswegeplans hat die LPA in einer zugehörigen Stellungnahme u.a. bezüglich der Optimierung und Verbesserung der Schienenhinterlandanbindung dieses gefordert.
Derzeitiger Sachstand ist, dass durch die Planungen im SPFV (also durch die FFBQ) sowie im SPNV (Stichwort: geplante Taktverdichtung) und im SGV (also durch die FFBQ) die möglichen Entwicklungspotenziale der hafenbezogenen SGV-Verkehre (also konventioneller Schienengüterverkehr und Kombiverkehr) zukünftig eingeschränkt erscheint. Hier ist gemeinschaftlich vom Lübecker Hafen Sorge zu tragen, dass hier keine Hemmnisse und somit Wettbewerbsnachteile entstehen.
Zusammenfassend lassen sich mit Blick auf den Korridor Lübeck – Hamburg folgende Aussagen zur zukünftigen Kapazitätssituation treffen. Der zurzeit gültige Bedarfsplan für die Bundesschienenwege erwartet für die Strecke Lübeck – Hamburg nach Fertigstellung der gesamten FFBQ ca. 120 Güterzüge und rund 100 Personenzüge. Die separat geplante S-Bahn-Strecke im Zielzustand wird geeignet sein, im stadtnahen Bereich Mengen vergleichbar den bestehenden S-Bahn-Strecken aufzunehmen, die durchaus 250 Fahrten je Tag und Richtung betragen. Unter Berücksichtigung der in der FFBQ-Prognose ermittelten Zahl von 78 Güterzügen ergibt sich rechnerisch eine Restkapazität von 42 Güterzügen mit Quelle bzw. Ziel in Lübeck. Allerdings zeigen sich bereits heute vereinzelt Probleme bzgl. der Trassenverfügbarkeit in Folge von Spitzennachfragen. Hiervon ist auch in Zukunft auszugehen, da grundsätzlich keine gleichförmige Nachfrage nach Trassen unterstellt werden kann.
Eine bahntechnische Nordanbindung des Skandinavienkais an die neue FFBQ-Strecke erscheint auch im Hinblick auf den aktuellen BVWP2030 ein Thema für die Zeit nach 2030 zu sein, welches als Option zukünftig weiter geprüft werden sollte.
3 Empfehlungen
- Aktive Arbeit für das Lübecker Schienennetz zur Vermeidung von Kapazitätsengpässen für den Lübecker Hafen (u. a. Unterstützung des Baus der S4 und alternativer Gleisstrecken wie Bad Kleinen oder Lübeck-Lüneburg)
- Räumliche Trennung der schienengebundenen Verkehre KV, Auto und Stückgut am Skandinavienkai
- Stufenweiser Ausbau der bestehenden KV-Kapazitäten durch stufenweisen Ausbau der vorhandenen Anlage – Beobachtung der Entwicklung der KV-Umschlagmengen und ggf. Anpassung der beschriebenen Strategie
- Angebotsdiversifizierung im konventionellen Schienengüterverkehr.
- Realisierung von ganzzuglangen Gleisen im Bereich Dänischburg-Siems.
- Optimierung des Bahnhofs Skandinavienkai mit dem Bau von drei zuglangen Gleisen
4 Nächste Schritte beim HEP2030
- Kenntnisnahme und Diskussion der Ergebnisse der übrigen Grundlagengutachten.
- Übernahme aller bis dahin vorhandenen Ergebnisse ins Gutachten 3 (Hafenumschlagprognose Lübeck für 2020, 2025 und 2030).
- Bearbeitung Block 3 läuft seit 1. Quartal 2015.
- HEP-Bearbeitung im Block 4 läuft seit 1. Quartal 2016.
Anlagen
Kurzfassung des Gutachtens 5
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
| 1 | öffentlich | Kurzfassung Gutachten 5 (499 KB) | |||