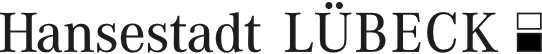- Bürgerservice
- Rathaus
Rathaus
- Rathaus
- Karriereportal
- Politik
- Verwaltung
- Verwaltung
- Antidiskriminierung bei der Hansestadt Lübeck
- Bürgermeisterkanzlei
- Büro der Bürgerschaft
- Feuerwehr
- Finanzen
- Frauenbüro
- Friedhöfe
- Gebäudemanagement
- Gesundheitsamt
- Gesundheitsamt
- Infektionsschutz und Hygiene
- Infektionsschutz und Hygiene
- Übertragbare Krankheiten
- Fragen und Antworten (FAQ)
- Hygieneüberwachung
- Tuberkuloseberatung
- Impfungen
- Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- Zahnärztlicher Dienst
- Amtsärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit
- Weitere Aufgaben
- Ihre Meinung zählt
- Tag der seelischen Gesundheit
- Konzernstruktur
- Kurbetrieb Travemünde
- Lübeck Port Authority
- Ordnungsamt
- Recht
- Soziale Sicherung
- Stabsstelle Migration und Ehrenamt
- Stadtgrün und Verkehr
- Stadtplanung und Bauordnung
- Stadtteilkonferenzen
- Stadtwald
- Standesamt
- Statistik
- Stiftungsverwaltung
- Straßenverkehrsbehörde
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Naturschutz
- Naturschutz
- Schutzgebiete
- Schutzgebiete
- Naturdenkmale flächenhaft
- Naturdenkmale objektbezogen
- Naturdenkmale objektbezogen
- Hängebuche in der Gärtnergasse
- Silberlinde am Koberg
- Ginkgo am Lindenplatz
- Bäume auf dem Jerusalemsberg
- Platanen auf dem Burgtorfriedhof
- Eichen am Waldsaum
- Lindenallee zum Gut Strecknitz
- Eichen- und Lindenallee in Padelügge
- Eichen vor der Schule in Niendorf
- Eichen auf dem Jahnplatz
- Natura 2000-Gebiete
- Geschützte Landschaftsbestandteile
- Naturschutzgebiete
- Landschaftsschutzgebiete
- Arten- und Biotopschutz
- Landschaftsplanung
- Erholung und Natur
- Projekte
- Klima
- Wasser
- Abfall
- Boden
- Lebensmittelüberwachung
- Veterinärwesen
- Gesundheitlicher Umweltschutz
- Hilfe in Notlagen
- Wirtschaft und Liegenschaften
- Wohnraum für Studierende
- Lübeck international
- Stadtleben
Stadtleben
- Stadtleben
- Familie und Bildung
- Familie und Bildung
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Stillfreundliche Stadt
- Beratung und Bildung
- Beratung und Bildung
- Beratung in der Schwangerschaft
- Willkommensbesuche
- Beratungsstellen Frühe Hilfen
- Familienzentren
- Familienzentren
- Familienzentrum / Kita Brüder-Grimm-Ring
- Familienzentrum / Kita Familienkiste
- Familienzentrum / Kita Schaluppenweg
- Familienzentrum / Kita Willy Brandt
- Familienzentrum / Kita St. Bonifatius
- AWO-Familienzentrum / Kita Redderkoppel
- Familienzentrum / Kinderhaus Pellwormstraße
- Familienzentrum / Kita Behaimring
- Familienzentrum / Kita Dreifaltigkeit
- Familienzentrum / Kita Helene Bresslau
- Familienzentrum / Kita Haus Barbara
- AWO-Familienzentrum / Kita Drachennest III
- Familienzentrum / Kita Kinderstube - Travemünde
- Familienzentrum / Kita Sprungtuch e.V. BunteKuh
- Familienzentrum / Kita Beim Meilenstein
- Familienzentrum Kinderhaus Alsheide
- Familienzentrum / Kinderclub
- Familienwegweiser
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen Jugendamt
- Familienbildung
- Telefon-Hotlines
- Beratungsstellen für Familien
- Kindertagesbetreuung
- Jugendamt
- Finanzielle Unterstützung
- Elterngeld/Kindergeld
- Freizeit
- Kinder von 3 - 6
- Kinder von 6 - 12
- Kinder von 6 - 12
- Schule
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Beratung und Unterstützung
- Beratung und Unterstützung
- Finanzielle Unterstützung
- Hilfe und Tipps für Kinder und Jugendliche
- Beratungsstellen für Familien
- Schulpsychologische Beratungsstelle
- Schulsozialarbeit
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen des Jugendamtes
- Telefon-Hotlines
- Familienservice
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Jugendamt
- Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Jugendliche
- Jugendliche
- Schule
- Schule und dann?
- Berufsausbildung
- Studium
- Jugendarbeit
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Jugendamt
- Beratung und Unterstützung
- Kinder- und Jugendbeteiligung
- Weitere Angebote
- Kinder- und Jugendschutz
- Sport
- Erwachsene
- Bildungsplanung
- Tourismus
- Tourismus
- Lübeck
- Travemünde
- Travemünde
- 200 Jahre Ostseebad
- Schiffe gucken
- Sehenswertes in Travemünde
- Strandleben
- Stadtplan Travemünde
- Travemünder Woche
- Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr
- Freizeit
- Freizeit
- LübeckCard
- Mobilität
- Lübecker Schwimmbäder
- Natur erleben
- Grünanlagen und Spielplätze
- Grünanlagen und Spielplätze
- Stadteingänge
- Patenschaften
- Private Feiern im öffentlichen Grün
- Grillen in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Baum des Jahres
- Baum des Jahres
- Stiel-Eiche
- Rot-Buche
- Sommer-Linde
- Berg-Ulme
- Speierling
- Gewöhnliche Eibe
- Spitz-Ahorn
- Hainbuche
- Eberesche
- Wild-Birne
- Silber-Weide
- Sandbirke
- Gewöhnliche Esche
- Gewöhnlicher Wacholder
- Schwarz-Erle
- Weiß-Tanne
- Rosskastanie
- Schwarz-Pappel
- Wald-Kiefer
- Walnuss
- Berg-Ahorn
- Vogel-Kirsche
- Elsbeere
- Europäische Lärche
- Wild-Apfel
- Trauben-Eiche
- Feld-Ahorn
- Winter-Linde
- Fichte
- Esskastanie
- Flatterulme
- Robinie
- Stechpalme
- Rot-Buche
- Moor-Birke
- Mehlbeere
- Roteiche
- Karte Baum des Jahres
- Schnullerbaum
- Baumkataster
- Klimabäume
- Baumspende
- Habitatbäume
- Anders parken – Bäume schützen
- Grün- und Parkanlagen
- Stadtnahe Erholung
- Spielen in der Stadt
- Sport
- Wochenmärkte
- Weihnachtsmärkte
- Schwimm- und Badegewässer
- Laternenumzug
- Kultur
- Kultur
- Museen
- Museen
- Museum Holstentor
- Buddenbrookhaus
- Günter Grass-Haus
- Kunsthalle St. Annen
- Museum Behnhaus Drägerhaus
- Willy-Brandt-Haus
- Museum für Natur und Umwelt
- KOLK 17 Figurentheater & Museum
- Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk
- Grenzmuseum
- Europäisches Hansemuseum
- Katharinenkirche
- St. Annen-Museum
- Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck
- Niederegger Marzipansalon
- Museum Alter Leuchtturm Travemünde
- Overbeck-Gesellschaft
- Museum Haus Hansestadt Danzig
- Theater
- Musik- & Kongresshalle
- Schleswig-Holstein Musik Festival
- Nordische Filmtage Lübeck
- Musikhochschule
- Bibliothek der Hansestadt Lübeck
- Stadtarchiv
- Kulturbüro
- Historische Pflaster
- Archäologie und Denkmalpflege
- Stolpersteine
- Galerien
- Filmstadt Lübeck
- Gedenkstätte Lübecker Märtyrer
- Wissenschaftspfad
- Kolosseum Lübeck
- Wohnen in Lübeck
- Veranstaltungen
- Stadtentwicklung
Stadtentwicklung
- Stadtentwicklung
- Lärmschutz
- Radverkehr
- Klima
- Klima
- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel
- Nachhaltigkeit
- Klimafonds
- Smart City Lübeck
- Smart City Lübeck
- Smart City Family
- Projekte und Maßnahmen
- Wir digital für Lübeck
- Digitale Strategie
- Smart City Infrastruktur
- Beteiligung
- überMORGEN
- überMORGEN
- Stadtentwicklungsdialog
- Rahmenplan und Mobilitätskonzept Innenstadt
- Verkehrsentwicklungsplan
- Stadtteilveranstaltungen
- Flächennutzungsplan
- Radverkehrskonzept
- Hafenentwicklungsplan
- Touristisches Entwicklungskonzept
- Kommunales Integrationskonzept
- Umfrage Klimaschutzmaßnahmen für 2021
- Masterplan Klimaschutz
- Übergangsweise
- Wirtschaftsförderung
- Priwall-Promenade
- Stadtplanung
- Stadtplanung
- Einzelhandelskonzepte
- Gewerbeflächen
- Wohnungsmarktberichte
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Verkehrskonzepte / ÖPNV
- Lübeck 2030
- Aktuelle Wohnbauprojekte
- Wohnquartier Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld
- Gründungsviertel
- Bauleitplanung
- Städtebauförderung
- Infrastruktur
- Stadtbildpflege
- Verkehrsmanagementsystem
- Hafen Lübeck
- Sportentwicklung
- Fehmarnbeltquerung
- Presse
Vorlage - VO/2023/12447
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag
- Die Variante (V-1) „3-steifige Grundinstandsetzung“ wird zur weiteren Planungsbearbeitung beschlossen.
- Die Prüfung der Ausführbar- und Genehmigungsfähigkeit einer möglichen Erweiterung der Geh- und Radwege unter statisch-konstruktiven sowie stadtbild- und denkmalpflegerischen Gesichtspunkten zur Schaffung zusätzlicher Verkehrsflächen (V-1a) wird beschlossen.
Verfahren
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja | ||||||||||
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein- Begründung:
| ||||||||||
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
Die Maßnahme ist: |
| neu | ||||||||||
|
| freiwillig | ||||||||||
| X | vorgeschrieben durch: | ||||||||||
|
| die Verkehrssicherungspflicht der Hanse-stadt Lübeck gem. § 10 StrWG SH | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
Finanzielle Auswirkungen: |
| Ja (Anlage 1) | ||||||||||
| X | Nein | ||||||||||
Auswirkung auf den Klimaschutz: |
| Nein |
| X | Ja – Begründung: |
|
| Durch die Baumaßnahme entsteht zunächst ein zusätzlicher CO2-Ausstoß. Die Baumaßnahme dient jedoch der Verlängerung der Lebensdauer des Bauwerks. Ein Ersatzneubau hätte einen ungleich höheren CO2-Ausstoß zur Folge. |
|
|
|
Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:
|
|
|
Begründung
Notwendigkeit der Baumaßnahme
Mit der Vorlage VO/2022/11418 vom 31.08.2022 „Altstadtbrückenbericht und Bauprogramm bis 2037“ informierte der Bereich Stadtgrün und Verkehr die politischen Gremien über die geplanten Brückenbaumaßnahmen, insbesondere über die kurzfristig anstehenden Maßnahmen. Dazu gehört auch die Mühlentorbrücke. Mit einer Zustandsnote von 3,9 wird dem Bauwerk ein ungenügender Bauwerkszustand attestiert. Das bedeutet, eine umgehende Instandsetzung bzw. ein Ersatzneubau ist erforderlich, um die Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit sicher zu stellen.
Bestandsbauwerk
Die Mühlentorbrücke, erbaut im Jahr 1898, überführt die Straße Mühlenbrücke (K23) über den Elbe-Lübeck-Kanal und stellt eine wichtige Verbindung zwischen den südlich gelegenen Stadtteilen und der Innenstadt dar. Für den Straßenverkehr und hier insbesondere für den öffentlichen Personennahverkehr, Rettungsdienste und die Ver- und Entsorgungsverkehre (Warenanlieferung etc.) ist die Mühlentorbrücke von existentieller Bedeutung.

Abb. 1: Seitenansicht (2021, Blickrichtung Possehlbrücke)

Abb. 2: Lageplan (Auszug aus Geoportal HL)
Es handelt sich bei der Mühlentorbrücke um eine 3-Feld-Fachwerkhängebrücke (Zügelgurtbrücke), die unter Denkmalschutz steht (siehe Denkmalliste der Hansestadt Lübeck, Objekt-Nr. 1652).
Die Mühlentorbrücke ist eine Zügelgurtbrücke mit zwei Fachwerkhauptträgern. Die Stützweiten und weitere Bauwerksdaten können in der folgenden Tabelle entnommen werden. Die Fahrbahnplatte bildet sich aus Buckelblechen, Längs- und Querträgern. Die Lasten der Fahrbahn und der Geh- und Radwege werden über Hänger in die Ketten geleitet, die ihrerseits die Lasten an jeweils zwei Pylone abgeben. Die Endbereiche der Brücke weisen eine schiefwinklige Lagerung auf. Die vorhandene Stahlkonstruktion ist überwiegend genietet.
Bauwerksdaten:
Interne Bauwerksbezeichnung (BW-Nr.) | BW 005 |
Bauwerksname | Mühlentorbrücke |
Brückenklasse nach DIN 1072 | 60 |
Gesamtlänge | ca. 81,11 m |
Breite zwischen den Geländern (Nutzbreite) | 18,88 m |
Fahrbahnbreite | 9,60 m |
Brückenfläche | 1531 m² |
Lichte Breite | 28,50 m |
Lichte Höhe | 6,17 m ü MW |
Schifffahrtsprofil | 5,50 m ü MW |
Konstruktion/ Bauart | Zügelgurtbrücke, 3 Feldträger |
Bauzustandsnote nach DIN 1076 | 3,9 |
Baujahr | 1898 |
Kreuzungswinkel | 64,63 gon |
Stützweiten | 19,664 m – 41,786 m – 19,664 m |
Gründung | Widerlager flach gegründet, Pfeiler auf Holzpfählen tief gegründet |
Bauwerkszustand (Schadensbilder, -ursachen und -bewertung)
Gemäß DIN 1076 ist der Bauwerkszustand der Mühlentorbrücke mit 3,9, d. h. ungenügender Bauwerkszustand bewertet. Gemäß Definition bedeutet dies: „Die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit sind erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben. Die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes ist u. U. nicht mehr gegeben. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung kann kurzfristig dazu führen, dass die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sind oder dass sich ein irreparabler Bauwerksverfall einstellt. Laufende Unterhaltung und umgehende Instandsetzung bzw. Erneuerung sind erforderlich. Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können sofort erforderlich sein.“
Bespielhaft seien ein paar Schadensbilder genannt:
- Überbau – Zügelgurt
- Abplatzungen mit freiliegender Bewehrung an den Unterseiten der Gehwegfertigteilplatten
- Stahlplatte und Konsolen am Endquerträger stellenweise verrostet
- Buckelbleche mehrfach durchgerostet
- Fachwerk der Tragkonstruktion mehrfach bzw. ausgeprägt verrostet/durchgerostet
- Pylone stellenweise verrostet mit Querschnittsschwächung und abgeplatzter Beschichtung


Abb. 3 und 4: Schadensbeispiele fortgeschrittener Korrosion am Tragwerk
- Unterbauten – Widerlager
- Verblendmauerwerk mit durchgehenden Längsrissen, teilweise Abplatzungen
- Lagersockel stellenweise gerissen, teilweise mit Abplatzungen


Abb. 5 und 6: Schadensbeispiele Verblendmauerwerk Widerlager
- Lager - Stelzenlager
- Lager bereichsweise verrostet mit Blattrostbildung, stellenweise abgeplatzte Beschichtung

Abb. 7: Korrosionsschäden am Lager
Die Ursache der Schäden ist der Standzeit von ca. 125 Jahren geschuldet. Zudem wurden vorhandene Schäden über Jahrzehnte nicht frühzeitig instandgesetzt, welches Folgeschäden und eine Schadensausbreitung bzw. –erweiterung zur Folge hat.
Aufgrund der Vielzahl der Schäden und des erhöhten Verkehrsaufkommens werden bereits vierteljährliche Sonderprüfungen zur Überwachung möglicher Schadenserweiterungen nach DIN 1076 durchgeführt. Die Kragarme inkl. Gehwegplatten sind aufgrund der starken Schädigung zudem für den Geh- und Radverkehr voll gesperrt.
Nachrechnung und Machbarkeitsstudie zur Instandsetzungsfähigkeit
Um für die Ausschreibung der Objekt- und Tragwerksplanung – gerade im Hinblick auf die denkmalgerechte Instandsetzung – eine passende Aufgabenstellung zu formulieren und geeignete Eignungs- und Zuschlagskriterien zusammenzustellen, war zu prüfen, ob technisch eine Instandsetzung noch möglich ist. Dafür wurde ein „Gutachten zur Machbarkeit einer Instandsetzung und Entwicklung von kurzfristigen Maßnahmen zur Sicherstellung des Verkehrs“ bei einem Ingenieurbüro beauftragt.
Am Ende dieses Ingenieurauftrages stand ein Gutachten, welches insbesondere:
a) künftige kurzfristige Verkehrseinschränkungen/-führungen vorschlägt,
b) die Nachrechnungsergebnisse enthält und auswertet,
c) Auskunft über die Möglichkeit einer Instandsetzung gibt,
d) die Randbedingungen einer möglichen Instandsetzung vorgibt,
e) eine qualitative Aussage zur Wirtschaftlichkeit ggü. einem Ersatzneubau enthält,
f) Aussagen über die Restnutzungsdauer des instandgesetzten Bauwerkes trifft und
g) Empfehlungen zu weiteren Maßnahmen ausspricht.
Für die Feststellung, inwieweit eine Instandsetzung noch technisch möglich ist (siehe Aufgabe c)), waren aufwändige statische Berechnungen notwendig. Grundlage für diese Berechnungen bildet die Richtlinie zur Nachrechnung von Straßenbrücken im Bestand (Nachrechnungsrichtlinie NRR, Stand: 05/2011) herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
Die Nachrechnungsrichtlinie bietet durch spezielle Regelungen und Vorgaben die Möglichkeit, die Reserven des Tragwerks und der Baustoffe auszunutzen, ohne das geforderte Zuverlässigkeitsniveau einzuschränken (aus NRR 1 (4)).
Bei der Nachrechnung von bestehenden Straßenbrücken nach der Richtlinie handelt es sich um ein gestuftes Verfahren, bei dem die Nachweisführung und ggf. der Untersuchungsaufwand am Bauwerk unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen modifiziert werden (aus NRR 4.2 (1)).
Herangehensweise und Ergebnisse der Nachrechnungen
Als ersten Schritt wurden die Nachrechnungen im IST-Zustand mit zwei eingeengten Fahrspuren (vor Inbetriebnahme der Behelfsbrücke), seitlichen Geh- und Radwegen, gesperrten Kragarmen und vorhandener Abrostungen geführt.
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass:
- die Hauptträger der Tragkonstruktion unter Berücksichtigung der Abrostung eine ausreichende Tragfähigkeit im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT, d.h. alle Grenzzustände, die die Sicherheit des Tragwerks und/oder die Sicherheit von Personen etc. betreffen) für die Brückenklasse 30/30 nachgewiesen sind.
- es bei dem Nachweis der Ermüdungssicherheit (Ermüdungslastmodell ELM 3) teilweise zu deutlichen Überschreitungen im Untergurt ca. 190%, kam.
- bei der nachfolgenden genauen Betrachtung unter Zugrundelegung des Ermüdungslastmodells 4 mit der Verkehrskategorie 3 (Ortsverkehr) die Ausnutzung der Hauptträger bei max. 77% liegt und damit die Ermüdungsnachweise der Hauptträger rechnerisch für die nächsten 30 Jahre erfüllt sind.
- für die Querträger und Endquerträger eine ausreichende Tragfähigkeit der Brückenklasse 60 (Bk 60) und ELM 3 und für die Fahrbahn eine ausreichende Tragfähigkeit gemäß Bk 30/30 nachgewiesen wurde.
Die Kragarme und Gehwegfertigteilplatten wurden aufgrund der fortgeschrittenen Schädigung nicht nachgerechnet.
Im zweiten Schritt wurde, um den hohen verkehrstechnischen Anforderungen in diesem Bereich gerecht zu werden, die Nachrechnung mit drei Fahrstreifen (Belastungen der Brückenklasse 30/30) und der Nutzung der Kragarme für den Geh- und Radwegbereich inkl. Abrostung durchgeführt.
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass:
- aufgrund von Spannungsüberschreitungen keine ausreichende Tragfähigkeit des Haupttragwerkes nachgewiesen wurde. Bei Ober- und Untergurten, Diagonalen und Vertikalen wurde eine Ausnutzung von 116 % ermittelt.
Im dritten Schritt wurde die Nachrechnung mit 2 Fahrstreifen (Belastungen der Brückenklasse 30/30) und der Nutzung der Kragarme für den Geh- und Radwegbereich inkl. Abrostung durchgeführt.
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass:
- aufgrund von Spannungsüberschreitungen keine ausreichende Tragfähigkeit des Haupttragwerkes nachgewiesen wurde. Bei Diagonalen und Vertikalen wurde eine Ausnutzung von 109 % ermittelt.
Im vierten Schritt wurde das statische System aus Längsträgern und der Fahrbahn aus Buckelblechen in eine orthotrope Platte (Änderung des statischen Systems) mit zwei Fahrstreifen (Belastungen Bk 30/30, Gesamtbreite 7,00 m) und der Nutzung der Kragarme für den Geh- und Radwegbereich inkl. Abrostung nachgerechnet.
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass:
- für Untergurte, Diagonalen und Vertikalen Ausnutzungen von 91 % bis 93 % ermittelt wurden.
- die Obergurte zu 103 % ausgenutzt werden. Die geringen Überschreitungen bei den Obergurten werden als unkritisch eingestuft.
Zusammenfassung der Ergebnisse der Nachrechnung
IST-Zustand mit 2 eingeengten Fahrspuren, seitlichen Geh- und Radwegen, gesperrten Kragarmen und vorhandener Abrostungen; (vor Inbetriebnahme der Behelfsbrücke) | ohne bauliche Verstärkungsmaßnahmen nachgewiesen | ||
| |||
| |||
3 Fahrstreifen (Belastungen Bk 30/30) und der Nutzung der Kragarme für den Geh- und Radwegbereich inkl. Abrostung; (IST-Zustand vor Verkehrseinschränkung) | ohne bauliche Verstärkungsmaßnahmen nicht nachgewiesen | ||
| |||
|
|
| |
2 Fahrstreifen (Belastungen Bk 30/30) und der Nutzung der Kragarme für den Geh- und Radwegbereich inkl. Abrostung | ohne bauliche Verstärkungsmaßnahmen nicht nachgewiesen | ||
| |||
| |||
Änderung des stat. System mit 2 Fahrspuren (Bk 30/30, Gesamtbreite 7,00 m) und der Nutzung der Kragarme für den Geh- und Radwegbereich inkl. Abrostung | ohne bauliche Verstärkungsmaßnahmen nachgewiesen | ||
| |||
Fazit: Ohne bauliche Verstärkungsmaßnahmen ist eine dreistreifige Nutzung der Mühlentorbrücke nicht möglich.
Grundsätzliches zu Instandsetzungen von denkmalgeschützten Bauwerken und deren Ersatzneubauten
In der Vorlage VO/2022/11418 vom 31.08.2022 „Altstadtbrückenbericht und Bauprogramm bis 2037“ werden unter Pkt. 3 (ab Seite 4) das Spannungsfeld zwischen Denkmalschutz und modernem Verkehr sowie mögliche Lösungsansätze erläutert.
Auf der einen Seite sind historische und stadtbildprägende Bauwerke, die Generationen von Lübecker:innen bekannt und als Zeugnis der Ingenieurkunst vergangener Jahrzehnte denkmalgeschützt sind.
Auf der anderen Seite stehen die Anforderungen an einen modernen Verkehr und die Sicherstellung der Erreichbarkeit z. B. der Lübecker Innenstadt für Polizei und Rettungsdienste und die tägliche Ver- und Entsorgung durch Liefer-, Müll- und Reinigungsfahrzeuge.
Hier gilt es einen Kompromiss zu finden, der soweit möglich, allen Belangen in zufriedenstellendem Ausmaß gerecht wird.
Auch nach einer Instandsetzung handelt es sich um ein – wie im Fall der Mühlentorbrücke – über 120 Jahre altes und sehr unterhaltungsaufwändiges Brückenbauwerk.
Bei der Abwägung Instandsetzung oder Ersatzneubau kann es sein, dass eine Instandsetzung nicht wirtschaftlich im Sinne einer nachhaltigen Finanzplanung ist, jedoch aus anderen – nicht monetären – Gründen befürwortet wird.
Variantenuntersuchung - Instandsetzungsmöglichkeiten
Für die im folgenden beschriebenen Instandsetzungsvarianten V-1 bis V-3 gilt:
- Bei den Instandsetzungsmaßnahmen wird von einer zusätzlichen Lebensdauer für das Brückenbauwerk von 30 Jahren ausgegangen.
- Die vorhandene Fahrbahnplatte aus Buckelblechen und Längsträgern wird zur Entlastung der Hauptträger zu einer orthotropen Platte (s. S. 7 oben) umgebaut. Dazu ist der vollständige Rückbau der Bestandsfahrbahnplatte erforderlich.
- Die bereits gesperrten Kragarme werden vollständig ersetzt. Eine Verlängerung der Kragarme ist aus statischer Sicht nicht möglich, da dies zu einer weiteren Erhöhung der ohnehin hohen Beanspruchung des Bauwerkes führen würde.
- Widerlager inkl. Zugverankerungen und Flügelwände werden abgebrochen und neu hergestellt.
- Aufgrund der Notwendigkeit die Widerlager abzubrechen und der damit verbundenen Baugrubenherstellung, sind nicht unerhebliche Eingriffe in den direkten Naturbereich nicht vermeidbar.
- Die vorhandene Holzpfahlgründung der Pfeiler und die Pfeiler selbst bleiben erhalten. Bei den regelmäßigen Messungen wurden keine nennenswerten Verschiebungen festgestellt. Das deutet auf eine intakte Gründung hin.
- Die Straße Mühlentorbrücke sowie die Uferwege unterhalb der Mühlentorbrücke werden während der gesamten Bauzeit für den Verkehr gesperrt. Für die Schifffahrt ist mit Einschränkungen zu rechnen.
- Die Konstruktion der Leitwerke ist auf die aktuell gültigen Normen anzupassen.
Hinweis: Die folgenden schematischen Darstellungen dienen der Veranschaulichung. Die Verkehrsaufteilungen mit verfügbaren Breiten sind nur beispielhaft und in einem begrenzten Rahmen variabel.
V-1 Instandsetzung 3-streifig, Brückenklasse 60 (Zustand vor den verkehrlichen Einschränkungen)

Abb. 8: Schematische Darstellung Variante V-1
Die Stahlkonstruktion kann instandgesetzt werden. Es können – nach vollständiger Entfernung des Korrosionsschutzes – weitreichend Bauteile erhalten werden. Der Umfang der auszutauschenden Bleche und zu ergänzenden Bauteile als Verstärkungsmaßnahmen ist groß.
Aufgrund des hohen Anteils der Verstärkungsmaßnahmen wird von einer mehrjährigen Bauzeit ausgegangen. Im Vergleich zu den im weiteren vorgestellten Instandsetzungsmaßnahmen wird diese Variante die längste Bauzeit haben.
Die nach den Richtlinien erforderlichen Rad- und Gehwegbreiten von je min. 2,00 m können bei dieser Instandsetzungsvariante nicht realisiert werden. Der Standard eines Radschnellweges (Mindestbreite 3,00 m bei Einrichtungsverkehr) ist nicht gewährleistet.
Es kann keine Förderung des Geh- und Radverkehrs über den Status quo hinaus erreicht werden.
Für den ÖPNV steht je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen zur Verfügung. Bei Beginn des linksabbiegenden Fahrstreifens in die Wallstraße auf dem Brückenbauwerk entstehen aus Sicht der Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH für den geradeausfahrenden ÖPNV keine zusätzlichen Wartezeiten.
Nach dem Lärmaktionsplan der Hansestadt Lübeck (2018/2019) wird die Mühlenstraße inkl. Mühlentorbrücke als Lärmschwerpunkt der ersten Priorität identifiziert. Gemäß Stellungnahme des Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz (UNV) wird von einer Erhöhung der Verkehrsbelastung ausgegangen, was wiederum zu einer Erhöhung der Lärmbelastung führen wird.
V-2 Instandsetzung 2-streifig, Brückenklasse 30/30

Abb. 9: Schematische Darstellung Variante V-2
Die Stahlkonstruktion kann instandgesetzt werden. Es können – nach vollständiger Entfernung des Korrosionsschutzes – weitreichend Bauteile erhalten werden. Der Umfang der auszutauschenden Bleche und zu ergänzenden Bauteile als Verstärkungsmaßnahmen ist geringer als bei Variante V-1.
Aufgrund des Anteils der Verstärkungsmaßnahmen wird von einer mehrjährigen Bauzeit ausgegangen. Im Vergleich zu v. g. vorgestellten Instandsetzungsmaßnahme V-1 wird diese Variante jedoch eine geringere Bauzeit haben.
Geh- und Radwege sind baulich voneinander getrennt.
Die nach den Richtlinien erforderliche Radwegbreite von min. 2,00 m können bei dieser Instandsetzungsvariante ebenfalls nicht realisiert werden. Der Standard eines Radschnellweges (Mindestbreite 3,00 m bei Einrichtungsverkehr) ist nicht gegeben.
Bei Verringerung der Fahrstreifen auf insgesamt 6,50 m sind Radfahrbreiten von max. 1,85 m möglich.
Es kann keine Förderung des Geh- und Radverkehrs über den Status quo hinaus erreicht werden.
V-3 Instandsetzung 1-streifig, Brückenklasse 30/30 für eine verkehrsberuhigte Zone mit Lieferverkehr und Rettungsfahrzeigen

Abb. 10: Schematische Darstellung Variante V-3
Die Stahlkonstruktion kann instandgesetzt werden. Es können – nach vollständiger Entfernung des Korrosionsschutzes – weitreichend Bauteile erhalten werden. Der Umfang der auszutauschenden Bleche und zu ergänzenden Bauteile als Verstärkungsmaßnahmen ist am geringsten bei den Instandsetzungsvarianten einzuschätzen.
Aufgrund des Anteils der Verstärkungsmaßnahmen wird von einer mehrjährigen Bauzeit ausgegangen. Im Vergleich zu v. g. vorgestellten Instandsetzungsmaßnahmen V-1 und V‑2 wird diese Variante die kürzeste Bauzeit haben.
Geh- und Radwege können baulich voneinander getrennt werden.
Die nach den Richtlinien erforderliche Radwegbreite von min. 2,00 m können bei dieser Instandsetzungsvariante realisiert werden. Der Standard eines Radschnellweges (Mindestbreite 3,00 m bei Einrichtungsverkehr) ist nicht gegeben.
Bei dieser Variante ist kein MIV zugelassen. Es ist ein Alternativroutenkonzept – sofern MIV in der Innenstadt weiterhin erlaubt wird – erforderlich.
Für den ÖPNV bedeutet diese Instandsetzungsvariante, dass die Mühlentorbrücke nicht mehr nutzbar wäre. Die Verlagerung des ÖPNV auf Wall- und Wahmstraße erscheint nicht sinnvoll, so dass ein vollständig neues ÖPNV-Konzept erforderlich würde.
Nach dem Lärmaktionsplan der Hansestadt Lübeck (2018/2019) wird die Mühlenstraße inkl. Mühlentorbrücke als Lärmschwerpunkt der ersten Priorität identifiziert. Gemäß Stellungnahme der UNV wird durch die Reduzierung auf einen Fahrstreifen und als verkehrsberuhigte Zone die Verkehrsbelastung und somit auch die Lärmbelastung reduziert werden. Diese Führung ist konform mit den Zielen der Lärmaktionsplanung.
Variantenuntersuchung - Ersatzneubauten
Für beide im folgenden beschriebenen Ersatzneubauvarianten V-4 und V-5 gilt:
- Je nach Konstruktionsweise beträgt die theoretische Nutzungsdauer nach Ablösebeträge-Berechnungsverordnung vom 01.07.2010 (ABBV) zwischen 70 bis 100 Jahren.
- Die Kragarme werden in der Breite für einen normgerechten Verkehr ausgelegt.
- Die Widerlager werden neu errichtet und können in der Lage für ausreichend Platz im Uferbereich angepasst werden.
- Aufgrund der Notwendigkeit die Widerlager abzubrechen und der damit verbundenen Baugrubenherstellung, sind nicht unerhebliche Eingriffe in den direkten Naturbereich nicht vermeidbar.
- Die vorhandene Holzpfahlgründung der Pfeiler und die Pfeiler werden abgebrochen. In Anlehnung an den Bestand können die Pfeiler mit einer Tiefgründung aus Bohrpfählen – in der Lage angepasst – hergestellt werden
- Die Straße Mühlentorbrücke sowie die Uferwege unterhalb der Mühlentorbrücke werden während der gesamten Bauzeit für den Verkehr gesperrt. Für die Schifffahrt ist mit Einschränkungen zu rechnen.
- Die Konstruktion der Leitwerke ist entsprechend den aktuell gültigen Normen auszuführen.
- Für den ÖPNV steht je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen zur Verfügung. Durch den separaten linksabbiegenden Fahrstreifen in die Wallstraße auf dem Brückenbauwerk, entstehen aus Sicht der Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH für den geradeausfahrenden ÖPNV keine zusätzlichen Wartezeiten.
- Die Leistungsfähigkeit ist für den ÖPNV erreicht, da vor und hinter dem Bauwerk keine Steigerung möglich ist.
- Das neue Brückenbauwerk wäre so zu konzipieren, dass eine Nutzung durch die Stadtbahn möglich wäre.
- Mit dem Abbruch der Mühlentorbrücke würde Lübeck eines seiner hervorragendsten Bauwerke verlieren. Eine Neuplanung an dieser sensiblen Stelle hätte die Einbindung von ICOMOS (International Council on Monuments and Sites/ Internationaler Rat für Denkmalpflege) bezüglich des Welterbes zur Folge.
- Nach dem Lärmaktionsplan der Hansestadt Lübeck (2018/2019) wird die Mühlenstraße inkl. Mühlentorbrücke als Lärmschwerpunkt der ersten Priorität identifiziert. Gemäß Stellungnahme der UNV wird von einer deutlichen Erhöhung der Verkehrsbelastung ausgegangen, was wiederum zu einer deutlichen Erhöhung der Lärmbelastung führen wird.
Hinweis: Die folgenden schematischen Darstellungen dienen der Veranschaulichung. Die Verkehrsaufteilungen mit verfügbaren Breiten sind nur beispielhaft und in einem begrenzten Rahmen variabel.
V-4 Ersatzneubau als Zügelgurtbrücke 4-streifig, Lastmodell nach Eurocode

Abb. 11: Schematische Darstellung Variante V-4
Die Stahlkonstruktion wird in Anlehnung an die vorhandene Konstruktion aus neuen und heute üblichen Stahlprofilen hergestellt (Stichwort: Retro-Look).
Die neue Fahrbahnplatte wird als orthotrope Platte mit einem ca. 8 bis 12 cm dicken Aufbau der Trag- und Deckschicht in Asphaltbauweise ausgeführt.
Die nach den Richtlinien erforderlichen Rad- und Gehwegbreiten von je min. 2,00 m können bei dieser Variante unter Verbreiterung der Kragarme realisiert werden. Der Standard eines Radschnellweges (Mindestbreite 3,00 m bei Einrichtungsverkehr) ist nicht gegeben.
V-5 Ersatzneubau als Stahlverbrücke 4-streifig, Lastmodell nach Eurocode

Abb. 12: Schematische Darstellung Variante V-5
Mit einer Stahlverbundbauweise werden die Materialien entsprechend dem heute Standard optimal eingesetzt. Bei einem integralen Bauwerk werden auch Lagerkonstruktionen und deren Wartung vermieden.
Die nach den Richtlinien erforderlichen Rad- und Gehwegbreiten von je min. 2,00 m können bei dieser Variante unter Verbreiterung der Kragarme realisiert werden. Der Standard eines Radschnellweges (Mindestbreite 3,00 m bei Einrichtungsverkehr) ist ebenso möglich.
V-1a Instandsetzung 3-streifig, Brückenklasse 60 und Verbreitung Geh- und Radwege durch getrennte Bauwerke („Anbauten“)
Bei einem Arbeitsgespräch am 08.12.2022 zu Vor- und Nachteilen und Machbarkeiten der Varianten V-1 bis V-5 mit den verkehrlich Beteiligten wie Polizei, Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH, Straßen- und Verkehrsplanung und den Kolleg:innen vom Denkmalschutz sowie dem Bereich UNV musste festgestellt werden, dass keine der fünf Varianten für alle Beteiligten gleichermaßen eine zufriedenstellende Lösung darstellt.
So ist zum Beispiel für die verkehrlich Beteiligten der Ersatzneubau V-5 die optimale Lösung während von Stadtbildpflege und Denkmalschutz die Instandsetzungsvariante mit dem geringsten Eingriff in die Bausubstanz bevorzugt wird. Aus Sicht des Natur- und Lärmschutzes ist die Variante V-3 die favorisierte Lösung, da die Eingriffe in die Natur am geringsten sind und aufgrund der Verkehrsberuhigung die Lärmimmissionen signifikant verringert werden können.
In der Auswertung des Arbeitsgespräches kam die Idee auf, eine Hybridlösung zu prüfen: Instandsetzung und Neubau.
Bei dieser Variante kommt die Instandsetzung V-1 zur Ausführung und es werden beidseitig – vom Bestandsbauwerk getrennte – Neubauten als Verbreiterung für den Geh- und Radweg hergestellt. Die Bauwerke sind nur optisch miteinander verbunden, statisch-konstruktiv sind es eigenständige Bauwerke.

Abb. 13: Schematische Darstellung Variante V-1a
Mit der Verbreiterung ist es möglich, dem Geh- und Radverkehr die nach ERA notwendige Breiten für Radwege von mind. 2,00 m und für Gehwege ebenfalls mind. 2,00 m bereitzustellen. Auch der Standard für den Radschnellweg mit einer Breite von 3,00 m kann gewährleistet werden.
Da es sich um separate Bauwerke handelt, die wesentlich zur Verbesserung des Radverkehrs beitragen, ist z.B. eine Zuwendung aus dem Förderprogramm „Stadt und Land“ zu prüfen.
ÖPNV und MIV steht der Verkehrsraum wie im Bestand – vor den derzeitigen Verkehrseinschränkungen – zur Verfügung.
Das denkmalgeschützte Bestandsbauwerk kann erhalten werden (siehe hierzu V-1). Eine intensive Abstimmung mit den Bereichen Denkmalpflege und Stadtbildpflege ist jedoch notwendig, da durch die neuen Teilbauwerke die wasserseitige Ansicht verändert wird. Für die Gestaltung wäre ein Ingenieurbüro mit entsprechender Expertise zu beauftragen.

Abb. 14: Visualisierung Variante V-1

Abb. 15: Visualisierung Variante V-1a (Verbreiterung)
Mit der Variante V-1a würde auch eine wesentliche Vorgabe der Maßnahmenblätter (MAKS) aus dem Masterplan Klimaschutz (hier: MO_Rad_7 Fahrradfreundliches Konzept für die Mühlentorbrücke) umgesetzt.
Konkret heißt es im Maßnahmenblatt: Da die Mühlentorbrücke mit 7.500 Radfahrenden die meist befahrene Straße zur Altstadt ist, ist ebendies bei der Neugestaltung zu berücksichtigen.
Der Masterplan Klimaschutz ist zwar noch nicht durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck beschlossen, jedoch entspricht die Förderung des Radverkehrs dem ökologischen Gedanken.

Abb. 16: Auszug MAKS MO_Rad_07
Immer wieder erhält die Abteilung Brückenbau Rückmeldung aus der Bevölkerung, ob die Behelfsbrücke nicht dauerhaft bleiben kann, da die Trennung zwischen Geh- und Radverkehr mit jeweils 3,00 m Breite als sehr positiv empfunden wird.
Mit der Variante V-1a ist es möglich, dem Geh- und Radverkehr jeweils eine komfortable eigene Verkehrsfläche und aufgrund der Lebensdauer der Neubauten (je nach Konstruktionsart zwischen 70 bis 100 Jahren) diese auch für einen langen Zeitraum zur Verfügung zu stellen.
Bei einem ggf. zukünftig erforderlich werdenden Ersatzneubau der „eigentlichen“ Mühlentorbrücke – unabhängig von der Wahl der Konstruktion – können später die Verbreiterungsbauten in das neue Bauwerk integriert werden.
Kosten der vorgeschlagenen Varianten
Aufgrund der Planungstiefe einer Machbarkeitsbarkeitsstudie können noch keine konkreten Bau- bzw. Projektkosten benannt werden.
Um für die Entscheidungsfindung eine Vergleichbarkeit der Varianten herzustellen, ist Aussage zur Kostenverteilung (in Prozent) auf Basis der unterschiedlichen Instandsetzungsumfänge erfolgt. Als Vergleichs-/Basiswert wurde die Variante 1 gewählt.
Für die Variante V-1a werden die hälftigen Kosten der Variante V-5 (mithin 45%) für die neuen Bauwerke angesetzt zzgl. zur der Variante V-1 mit 100%.
Die genauen Projektkosten auf Basis der Ingenieurverträge und der Kostenberechnung für die Bauleistungen werden zu einem späteren Zeitpunkt mit der üblichen Vorlage zur Projektfreigabe mitgeteilt.
Variante 1 | Instandsetzung 3-streifig, Brückenklasse 60 | 100 % |
Variante 2 | Instandsetzung 2-streifig, Brückenklasse 30/30 | 75 % |
Variante 3 | Instandsetzung -streifig, Brückenklasse 30/30 - verkehrsberuhigte Zone | 60 % |
Variante 4 | Ersatzneubau Zügelgurtbrücke, 4-streifig, EC-Lastmodell | 140 % |
Variante 5 | Ersatzneubau Stahlverbundbrücke, 4-streifig, EC-Lastmodell | 90 % |
Variante 1a | Instandsetzung 3-streifig, Brückenklasse 60 und Verbreitung Geh- und Radwege durch getrennte Bauwerke | 145 % |
Kreisverkehr Mühlentorteller
Da der Kreisverkehr Mühlentorteller als Unfallschwerpunkt gilt und um der daraus folgenden Forderung der Fachaufsicht der Straßenverkehrsbehörde, dem LBV.SH, den Kreisverkehr verkehrssicher umzugestalten, nachzukommen, wurde geprüft, wie die Verkehrssicherheit – gerade für den Schüler:innenverkehr – am besten gewährleistet werden kann.
Hierzu wird auf den Bericht für den Bauausschuss des Bereiches Stadtgrün und Verkehr „Mühlentorplatz – Umgestaltung zu einspurigen Kreisverkehr“ (VO/2023/12213) verwiesen.
Die Vorprüfung ergab, dass bei einem Ersatzneubau der Mühlentorbrücke mit vier Fahrstreifen oder einer dreistreifigen Instandsetzung (V-1) eine signalisierte Kreuzung die geeignetste Lösung bzgl. der wesentlichen Parameter -Sicherheit und Leistungsfähigkeit – darstellt.
Weitere Planung
Derzeit wird die Aufgabenstellung für die Objekt- und Tragwerksplanung erarbeitet, die nach Entscheidung über die weiter zu verfolgende Variante finalisiert und ausgeschrieben wird. Als Vergabeverfahren kommt, aufgrund der Notwendigkeit europaweit auszuschreiben, ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb zur Anwendung.
Die Baumaßnahme wird als BIM-Projekt (Building Information Modeling) geplant und ausgeführt. BIM ist eine Methode zur Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Bauwerken, die auf digitalen Modellen basiert. Grundsätzlich verspricht man sich von der Methode bessere Kosten- und Terminsicherheit, da die Baumaßnahme vorher „digital gebaut“ wird.
Hierzu wurde bereits ein BIM-Manager vertraglich gebunden. Derzeit werden die Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) erarbeitet und nach Entscheidung über die zu planende Variante fertiggestellt. Die AIA sind wesentlicher Baustein für die Aufgabenstellung der Objekt- und Tragwerksplanung.
Empfehlung
Der Bereich Stadtgrün und Verkehr empfiehlt, die Variante (V-1) „3-streifige Grundinstandsetzung“ zur weiteren Planungsbearbeitung und die Prüfung der Ausführbar- und Genehmigungsfähigkeit einer möglichen Erweiterung der Geh- und Radwege unter statisch-konstruktiven sowie stadt- und denkmalpflegerischen Gesichtspunkten zur Schaffung zusätzlicher Verkehrsflächen (V-1a) zu beschließen.
Anlagen