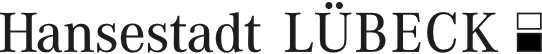- Bürgerservice
- Rathaus
Rathaus
- Rathaus
- Karriereportal
- Politik
- Verwaltung
- Verwaltung
- Antidiskriminierung bei der Hansestadt Lübeck
- Bürgermeisterkanzlei
- Büro der Bürgerschaft
- Feuerwehr
- Finanzen
- Frauenbüro
- Friedhöfe
- Gebäudemanagement
- Gesundheitsamt
- Gesundheitsamt
- Infektionsschutz und Hygiene
- Infektionsschutz und Hygiene
- Übertragbare Krankheiten
- Fragen und Antworten (FAQ)
- Hygieneüberwachung
- Tuberkuloseberatung
- Impfungen
- Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- Zahnärztlicher Dienst
- Amtsärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit
- Weitere Aufgaben
- Ihre Meinung zählt
- Tag der seelischen Gesundheit
- Konzernstruktur
- Kurbetrieb Travemünde
- Lübeck Port Authority
- Ordnungsamt
- Recht
- Soziale Sicherung
- Stabsstelle Migration und Ehrenamt
- Stadtgrün und Verkehr
- Stadtplanung und Bauordnung
- Stadtteilkonferenzen
- Stadtwald
- Standesamt
- Statistik
- Stiftungsverwaltung
- Straßenverkehrsbehörde
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Naturschutz
- Naturschutz
- Schutzgebiete
- Schutzgebiete
- Naturdenkmale flächenhaft
- Naturdenkmale objektbezogen
- Naturdenkmale objektbezogen
- Hängebuche in der Gärtnergasse
- Silberlinde am Koberg
- Ginkgo am Lindenplatz
- Bäume auf dem Jerusalemsberg
- Platanen auf dem Burgtorfriedhof
- Eichen am Waldsaum
- Lindenallee zum Gut Strecknitz
- Eichen- und Lindenallee in Padelügge
- Eichen vor der Schule in Niendorf
- Eichen auf dem Jahnplatz
- Natura 2000-Gebiete
- Geschützte Landschaftsbestandteile
- Naturschutzgebiete
- Landschaftsschutzgebiete
- Arten- und Biotopschutz
- Landschaftsplanung
- Erholung und Natur
- Projekte
- Klima
- Wasser
- Abfall
- Boden
- Lebensmittelüberwachung
- Veterinärwesen
- Gesundheitlicher Umweltschutz
- Hilfe in Notlagen
- Wirtschaft und Liegenschaften
- Wohnraum für Studierende
- Lübeck international
- Stadtleben
Stadtleben
- Stadtleben
- Familie und Bildung
- Familie und Bildung
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Stillfreundliche Stadt
- Beratung und Bildung
- Beratung und Bildung
- Beratung in der Schwangerschaft
- Willkommensbesuche
- Beratungsstellen Frühe Hilfen
- Familienzentren
- Familienzentren
- Familienzentrum / Kita Brüder-Grimm-Ring
- Familienzentrum / Kita Familienkiste
- Familienzentrum / Kita Schaluppenweg
- Familienzentrum / Kita Willy Brandt
- Familienzentrum / Kita St. Bonifatius
- AWO-Familienzentrum / Kita Redderkoppel
- Familienzentrum / Kinderhaus Pellwormstraße
- Familienzentrum / Kita Behaimring
- Familienzentrum / Kita Dreifaltigkeit
- Familienzentrum / Kita Helene Bresslau
- Familienzentrum / Kita Haus Barbara
- AWO-Familienzentrum / Kita Drachennest III
- Familienzentrum / Kita Kinderstube - Travemünde
- Familienzentrum / Kita Sprungtuch e.V. BunteKuh
- Familienzentrum / Kita Beim Meilenstein
- Familienzentrum Kinderhaus Alsheide
- Familienzentrum / Kinderclub
- Familienwegweiser
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen Jugendamt
- Familienbildung
- Telefon-Hotlines
- Beratungsstellen für Familien
- Kindertagesbetreuung
- Jugendamt
- Finanzielle Unterstützung
- Elterngeld/Kindergeld
- Freizeit
- Kinder von 3 - 6
- Kinder von 6 - 12
- Kinder von 6 - 12
- Schule
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Beratung und Unterstützung
- Beratung und Unterstützung
- Finanzielle Unterstützung
- Hilfe und Tipps für Kinder und Jugendliche
- Beratungsstellen für Familien
- Schulpsychologische Beratungsstelle
- Schulsozialarbeit
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen des Jugendamtes
- Telefon-Hotlines
- Familienservice
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Jugendamt
- Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Jugendliche
- Jugendliche
- Schule
- Schule und dann?
- Berufsausbildung
- Studium
- Jugendarbeit
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Jugendamt
- Beratung und Unterstützung
- Kinder- und Jugendbeteiligung
- Weitere Angebote
- Kinder- und Jugendschutz
- Sport
- Erwachsene
- Bildungsplanung
- Tourismus
- Tourismus
- Lübeck
- Travemünde
- Travemünde
- 200 Jahre Ostseebad
- Schiffe gucken
- Sehenswertes in Travemünde
- Strandleben
- Stadtplan Travemünde
- Travemünder Woche
- Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr
- Freizeit
- Freizeit
- LübeckCard
- Mobilität
- Lübecker Schwimmbäder
- Natur erleben
- Grünanlagen und Spielplätze
- Grünanlagen und Spielplätze
- Stadteingänge
- Patenschaften
- Private Feiern im öffentlichen Grün
- Grillen in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Baum des Jahres
- Baum des Jahres
- Stiel-Eiche
- Rot-Buche
- Sommer-Linde
- Berg-Ulme
- Speierling
- Gewöhnliche Eibe
- Spitz-Ahorn
- Hainbuche
- Eberesche
- Wild-Birne
- Silber-Weide
- Sandbirke
- Gewöhnliche Esche
- Gewöhnlicher Wacholder
- Schwarz-Erle
- Weiß-Tanne
- Rosskastanie
- Schwarz-Pappel
- Wald-Kiefer
- Walnuss
- Berg-Ahorn
- Vogel-Kirsche
- Elsbeere
- Europäische Lärche
- Wild-Apfel
- Trauben-Eiche
- Feld-Ahorn
- Winter-Linde
- Fichte
- Esskastanie
- Flatterulme
- Robinie
- Stechpalme
- Rot-Buche
- Moor-Birke
- Mehlbeere
- Roteiche
- Karte Baum des Jahres
- Schnullerbaum
- Baumkataster
- Klimabäume
- Baumspende
- Habitatbäume
- Anders parken – Bäume schützen
- Grün- und Parkanlagen
- Stadtnahe Erholung
- Spielen in der Stadt
- Sport
- Wochenmärkte
- Weihnachtsmärkte
- Schwimm- und Badegewässer
- Laternenumzug
- Kultur
- Kultur
- Museen
- Museen
- Museum Holstentor
- Buddenbrookhaus
- Günter Grass-Haus
- Kunsthalle St. Annen
- Museum Behnhaus Drägerhaus
- Willy-Brandt-Haus
- Museum für Natur und Umwelt
- KOLK 17 Figurentheater & Museum
- Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk
- Grenzmuseum
- Europäisches Hansemuseum
- Katharinenkirche
- St. Annen-Museum
- Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck
- Niederegger Marzipansalon
- Museum Alter Leuchtturm Travemünde
- Overbeck-Gesellschaft
- Museum Haus Hansestadt Danzig
- Theater
- Musik- & Kongresshalle
- Schleswig-Holstein Musik Festival
- Nordische Filmtage Lübeck
- Musikhochschule
- Bibliothek der Hansestadt Lübeck
- Stadtarchiv
- Kulturbüro
- Historische Pflaster
- Archäologie und Denkmalpflege
- Stolpersteine
- Galerien
- Filmstadt Lübeck
- Gedenkstätte Lübecker Märtyrer
- Wissenschaftspfad
- Kolosseum Lübeck
- Wohnen in Lübeck
- Veranstaltungen
- Stadtentwicklung
Stadtentwicklung
- Stadtentwicklung
- Lärmschutz
- Radverkehr
- Klima
- Klima
- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel
- Nachhaltigkeit
- Klimafonds
- Smart City Lübeck
- Smart City Lübeck
- Smart City Family
- Projekte und Maßnahmen
- Wir digital für Lübeck
- Digitale Strategie
- Smart City Infrastruktur
- Beteiligung
- überMORGEN
- überMORGEN
- Stadtentwicklungsdialog
- Rahmenplan und Mobilitätskonzept Innenstadt
- Verkehrsentwicklungsplan
- Stadtteilveranstaltungen
- Flächennutzungsplan
- Radverkehrskonzept
- Hafenentwicklungsplan
- Touristisches Entwicklungskonzept
- Kommunales Integrationskonzept
- Umfrage Klimaschutzmaßnahmen für 2021
- Masterplan Klimaschutz
- Übergangsweise
- Wirtschaftsförderung
- Priwall-Promenade
- Stadtplanung
- Stadtplanung
- Einzelhandelskonzepte
- Gewerbeflächen
- Wohnungsmarktberichte
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Verkehrskonzepte / ÖPNV
- Lübeck 2030
- Aktuelle Wohnbauprojekte
- Wohnquartier Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld
- Gründungsviertel
- Bauleitplanung
- Städtebauförderung
- Infrastruktur
- Stadtbildpflege
- Verkehrsmanagementsystem
- Hafen Lübeck
- Sportentwicklung
- Fehmarnbeltquerung
- Presse
Vorlage - VO/2022/11662
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag
Das Projekt zum Bau der Stadtgrabenbrücke wird freigegeben.
Verfahren
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen | X | Ja | ||||||||||||
gem. § 47 f GO ist erfolgt: |
| Nein- Begründung:
| ||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
Die Maßnahme ist: |
| neu | ||||||||||||
| X | freiwillig | ||||||||||||
|
| vorgeschrieben durch: | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
Finanzielle Auswirkungen: | X | Ja (Anlage 1) | ||||||||||||
|
| Nein | ||||||||||||
Auswirkung auf den Klimaschutz: |
| Nein |
| X | Ja – Begründung: |
|
| Der Bau der Brücke verbraucht Ressourcen, jedoch wird durch die Brücke der Radverkehr gefördert. Eine ausführliche Begründung erfolgt im Textteil. |
|
|
|
Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:
|
|
|
Begründung
1. Allgemeines
Mit Beschluss vom 31.01.2019 der Bürgerschaft (VO/2018/06794) wurde die Verwaltung, hier die Abteilung Brückenbau, beauftragt, den Bau der Stadtgrabenbrücke zu planen und durchzuführen.
Im Zusammenhang mit den Infrastrukturmaßnahmen zur Erschließung des B-Plan-Gebietes „Fackenburger Allee / Werftstraße“ wurde bereits in 2014 der Neubau einer Geh- und Radwegbrücke über den Stadtgraben mit der Eintragung einer Trasse festgelegt. Auch auf der gegenüberliegenden Seite an der Willy-Brandt-Allee ist bereits ein Flurstück seit Anfang der 1990er Jahre reserviert für die Anbindung der Brücke.
Die Brücke über den Stadtgraben verbindet die Lindenarkaden und den Bahnhofsbereich mit der Willy-Brandt-Allee und schließt an die bereits vorhandene Wegeverbindung westlich der Altstadtinsel über den Holstenhafen an. Sie komplettiert damit die Geh- und Radweganbindung der Lübecker Altstadt, die im Osten mit der Brücke über den Klughafen abschließt.
Darüber hinaus erhält die Brücke einen Anschluss an die beiden Uferwege des Stadtgrabens, womit das Wanderwegsystem innerhalb der Hansestadt Lübeck eine notwendige und sinnvolle Ergänzung erfährt, mit der die Erreichbarkeit und damit die Nutzbarkeit des innerstädtischen Erholungsbereiches deutlich verbessert wird.
2. Lage im Verkehrswegenetz
2.1. Stadtgraben
Für die Schifffahrt wird ein Schifffahrtsprofil von 5,00 m Höhe über Mittelwasser und eine Breite > 20,0 m (zentrisch zur Gewässermitte) gefordert.
Die kleinste lichte Durchfahrtshöhe der Brücke wird diese Forderung einhalten. Durch die Anordnung der Pfeiler im Uferbereich werden zudem die ohnehin eingeschränkten Sichtverhältnisse für die Schifffahrt im Kurvenbereich des Gewässers durch die Konstruktion der Brücke nicht zusätzlich negativ beeinträchtigt werden.
2.2. Uferwege
Bisher schließt der Uferweg auf der Westseite an den Radweg Werner-Kock-Straße an. An dem Schnittpunkt der beiden Wege ist ein kleiner Platz entstanden, an dem auch die Stadtgrabenbrücke anschließen wird. Die Fortführung nach Süden bis zur Puppenbrücke und die dortige Unterführung ist mittelfristig geplant im Zuge der neuen Bebauung des benachbarten Geländes durch die Fa. Hypoport.
Der Uferweg auf der Ostseite schließt im Norden an die Straße „Auf der Wallhalbinsel“ an und wird im Nebenfeld der Brücke mit einer lichte Höhe ≥ 2,50 m unterführt. Er führt ebenfalls zur Puppenbrücke. Eine Instandsetzung der dortigen Unterführungskonsole ist mittelfristig geplant und wird dann eine durchgehende Verbindung zu den Wallanlagen bis zur Possehlstraße ermöglichen.
2.3. Willy-Brandt-Allee, Altstadt
Die zentrale Straße auf der Wallhalbinsel ist die Willy-Brandt-Allee.
In der Machbarkeitsstudie für einen Radschnellweg von Bad Schwartau über Lübeck nach Groß Grönau ist die Willy-Brandt-Allee die Vorzugslösung. Von Norden kommend wird der Radverkehr über die Eutiner Eisenbahnbrücke und die Straße „Auf der Wallhalbinsel“ zurzeit an der Willy-Brandt-Allee und dann weiter in die Possehlstraße nach Süden geführt.
2.4. Die Stadtgrabenbrücke:
Im Westen der Brücke befindet sich fußläufig der Hauptbahnhof, sodass die Brücke nach ihrer Fertigstellung in der Linie Werner-Kock-Straße – Stadtgrabenbrücke – Willy-Brandt-Allee – Holstenhafenbrücke – Beckergrube als eine direkte Verbindung für den Geh- und Radverkehr zwischen dem Bahnhof und der Altstadt dient. Auf diese Weise soll gleichzeitig der Unfallschwerpunkt Lindenplatz (Lindenteller) entlastet werden.
Die Brücke und die anschließende Rampe überwinden auf einer Länge von ca. 120 m ein Höhenunterschied von ca. 3,20 m. Durch ein stetiges Längsgefälle von maximal 3 % Neigung kann auf Stufen und Ruhepodeste vollständig verzichtet werden und die Nutzung ist für mobilitätseingeschränkte Menschen und den Radverkehr gleichermaßen komfortabel. Am unteren Ende der Rampe bleibt eine kleine Strecke ohne Gefälle, dort ist die Anlage eines kleinen Platzes für die Geh- und Radverkehre vorgesehen, um eine gefahrlose Verflechtung der Verkehre in Nord-Südrichtung mit denen in Ost-Westrichtung zu ermöglichen. Insbesondere der bergabrollende Radverkehr wird gebremst, bevor er auf die Willy-Brandt-Allee trifft.
Zur Querung der Willy-Brandt-Allee wird eine Querungshilfe vorgesehen. Die Planung hierfür ist noch nicht abgeschlossen, es sind derzeit verschiedene Varianten in der Vorplanung, die den politischen Gremien noch gesondert vorgelegt werden (Anlage 2).
3. Beschreibung des Bauwerks
3.1 Bauwerksgestaltung
(Anlage 3, siehe auch mündl. Bericht im BA am 11.07.2022)
Im Zuge der Vorplanung wurden unterschiedliche Varianten für die Gestaltung der Brücke ausgearbeitet. Die Varianten wurden in Hinblick auf Nutzungsqualität, Konstruktion, Herstellverfahren, Gestaltung, Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit bewertet. Als Vorzugslösung wurde die Variante TRIA festgelegt:
Sie verzichtet bewusst auf hoch aufragende Bauteile wie Bögen oder Pylone. Mit einem Dreifeldbauwerk wird eine sinnvolle und wirtschaftliche Aufteilung der Gesamtstützweite erreicht, ohne störende Pfeiler in den Flusslauf zu stellen. Durch die Eingliederung der benötigten Pfeiler in die vorhandenen Baumreihungen wird die Brücke bestmöglich in ihre Umgebung integriert. Ebenso werden kleine, zurückgesetzte Widerlager unauffällig in den Böschungen angeordnet, wodurch der Eingriff in das Bodendenkmal minimiert wird.
In gestalterischer Hinsicht überzeugt die Variante durch die Aufnahme der asymmetrischen Umgebung, wodurch ein Alleinstellungsmerkmal der Brücke entsteht: Die Brücke nimmt das stetige Gefälle der Fahrbahn auf und spiegelt es in der Feldmitte. Über den Stützen wird die Kante gebrochen und wieder zurück zur Gradiente geführt. Die dadurch entstehenden Dreiecke liegen optimal im Momentenverlauf der Brücke, auf der Westseite als untenliegende Voute, auf der Ostseite als Trog oberhalb der Fahrbahn.
Die äußeren Kanten der Voute und des Troges liegen auf einer Linie, die sich mit der Gradiente kreuzt und dadurch in der Seitenansicht die Brücke symmetrisch erscheinen lassen.
Die beiden Längsträger werden als Stahlhohlkästen ausgeführt. Die Bauhöhe über den Stützen beträgt 1,50 m gegenüber 0,50 m in Feldmitte.
3.1.1 Beteiligung des Welterbe- und Gestaltungsbeirats
Am 05.05.2022 hat der Welterbe- und Gestaltungsbeirat (WGBR) in seiner 67. Sitzung die Vorentwürfe der Stadtgrabenbrücke zur Kenntnis und Bewertung erhalten und ausführlich behandelt. Es sind einige Kritikpunkte geäußert worden, die weitgehend in den endgültigen Entwurf übernommen werden konnten. Auf Anregung des WGBR wurde die Lage der Brücke verbessert und gleichzeitig konnten dadurch die Böschungen der Rampe flacher und gefälliger geplant werden.
Andere, die Konstruktion betreffende Kritikpunkte konnten nicht berücksichtigt werden, weil dadurch das Tragwerk erheblich verändert oder in der Funktion beeinträchtigt worden wäre.
3.2 Statische Gestaltung
Das statische System ist ein Durchlaufträger mit drei Feldern. Die Stützweiten betragen 13,25 / 35,85 / 14,10 m, die Gesamtlänge ergibt sich daraus mit 63,20 m. Die lichte Brückenbreite zwischen den Geländern beträgt 6,50 m.
Die beiden Pfeiler in den Stützbereichen werden federnd gelagerte Pendelstützen. Der Anschluss an die Widerlager erfolgt in integraler Bauweise, so dass für die Übergänge zu den Rampenbereichen lediglich bituminöse Fahrbahnübergänge erforderlich werden.
Die Gründung der Brücke erfolgt über eine Tiefgründung mit Mikropfählen. Diese haben den Vorteil, dass die Herstellung mit relativ kleinem Gerät und damit umwelt- und landschaftsschonend erfolgen kann.
Der Querschnitt des Überbaus ist über die Länge des Tragwerks veränderlich. Zwei außenliegende Stahl-Hohlkästen sind als Hauptträger vorgesehen, dazwischen spannen Querträger. Im Bereich des westlichen Pfeilers vergrößert sich die Bauhöhe des Hauptträgers nach unten, sodass eine Voute ausgebildet wird. Im östlichen Uferbereich nimmt die Höhe des Hauptträgers nach oben hin zu. Dadurch entsteht ein Trogquerschnitt im Stützbereich. In der Feldmitte des Hauptfeldes weist der Hauptträger die geringste Höhe auf.
Die Querträger im Stützbereich fallen etwas größer aus, da diese zusätzlich als Zugband zwischen den nach außen geneigten Pfeilern fungieren.
Die Brücke wird für Geh- und Radweglasten bemessen. Außerdem wird sie für Winterdient- und Unterhaltungsfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 6,0 t ausgelegt.
3.3. Nichtmetallisch bewehrte Fahrbahnplatte
Als Fahrbahnplatte ist ein basalt- oder carbonbewehrter Beton vorgesehen. Durch die nichtrostenden Bewehrungselemente und die damit verbundene geringe Betondeckung kann die Fahrbahnplatte vergleichsweise dünn und gewichtsparend gestaltet werden.
Der Wandel zu einer energie- und ressourcenschonenden Bauweise ist für eine Klimawende dringend geboten. Für diese Bauweise ist eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich, da sie bisher noch nicht durch die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) und das Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen wurde. Diese wird in Absprache mit dem Prüfamt für Standsicherheit und der Brückenunterhaltung durch die Hansestadt Lübeck selbst erteilt werden.
Die Mehrkosten für die Bewehrung werden durch die Einsparungen des Betons ausgeglichen, so dass diese Bauweise finanziell keine Mehrbelastung darstellt. Durch den möglichen Einsatz kleinerer Kräne und Transportmittel werden weitere Ressourcen und Finanzmittel eingespart.
4. Leitungsträger
Auf der Fläche, die für die Rampe vorgesehen ist, ist ein Leitungsrecht für eine Regenwasserkläranlage eingetragen, die für die Behandlung von Oberflächenwasser auf den Parkplatz- und Straßenflächen erforderlich und noch zu bauen ist. Es ist vorgesehen, die beiden Baumaßnahmen gleichzeitig durchzuführen.
Die Überführung von Leitungen ist mit dieser Brücke nicht notwendig. In Anlehnung an den Bauausschussbeschluss VO/2018/06329 vom 03.09.2018 wird eine spätere Nachrüstung von einigen Rohren vorgesehen.
5. Grunderwerb
Die Brücke wird weitgehend auf städtischem Gelände geplant. In dem B-Plan 03.02.00, Fackenburger Allee / Stadtgraben, ist sie als Querung des Stadtgrabens eingetragen.
Im B-Plan 01.73.00, Auf der Wallhalbinsel, ist eine Fläche zugunsten von Zufußgehenden eingetragen. Auf diesem Gelände soll die Rampe zur Willy-Brandt-Allee herabführen sowie die Zuwegung zum Uferweg.
Im direkten Anschluss an diese Fläche werden für die Rampenböschung ca. 100 m² Fläche von einem benachbarten Hotel benötigt. Die Fläche ist unbebaut und wird derzeit als Parkplatz genutzt, so dass eine Bebauung mit der Rampe möglich ist. Verhandlungen hierzu werden derzeit geführt und erscheinen sehr aussichtsreich.
6. Umweltverträglichkeit
Der Stadtgraben ist als Europäisches Schutzgebiet (FFH-Gebiet Travetal) ausgewiesen. Beeinträchtigungen der geschützten Biotope rechts und links des Stadtgrabens (jeweils ein mehr oder minder breiter Uferrandstreifen aus Gehölzen und Staudenfluren als Gewässerbegleitbiotope) und eine Störung der Biotopvernetzung am Gewässer sind weitgehend zu vermeiden oder wenigstens zu minimieren.
Bei der Planung wurde darauf geachtet, sensibel mit dem Naturraum des Stadtgrabens umzugehen und den Baumbestand zu erhalten. Durch die schlanken Pfeiler erfolgt in unmittelbarer Ufernähe nur ein minimaler Eingriff, der durch die Verwendung von Verpresspfählen unterstützt wird. Durch die minimierten Widerlager bleibt der Raum in den Seitenöffnungen offen für die Biotopvernetzung (z. B. für den Otter) und für die Naherholung auf dem östlichen Uferweg.
Eine besondere Betrachtung erfordert die Beleuchtung der Brücke: Diese ist in sehr engen Abstimmung mit dem Naturschutz erfolgt, da der Bereich der geplanten Brücke als potenziell wichtiges Fledermausjagdgebiet eingestuft ist. Alle Fledermausarten werden gem. BNatSchG als streng geschützt eingestuft. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch die geplante Beleuchtung ist derzeit im Wesentlichen eine Handlaufbeleuchtung geplant, die im Bereich der Widerlager durch jeweils eine Mastleuchte unterstützt wird. Außerdem wird geprüft, welche technische Möglichkeiten zum bewegungsabhängigen Schalten und Dimmen der Beleuchtung zum Tragen kommen können. Die gesamte Beleuchtung ist so einzustellen, dass möglichst wenig Lichtschein außerhalb der Verkehrsflächen entsteht. Vor allem die Handlaufbeleuchtung soll nicht in das Gewässer scheinen.
Durch die Ausnutzung der Brückenlänge für das Gefälle kommt die Rampe mit einem Damm von geringer Höhe aus, der vollständig begrünt werden kann. Damit entfällt der Bau von Stützbauwerken und Beton- oder Stahlflächen werden auf ein Minimum reduziert.
7. Auswirkung auf den Klimaschutz:
Seitens der Naturschutzbehörde wird der Bau der Brücke grundsätzlich begrüßt, aufgrund der Schaffung einer attraktiveren Anbindung der Altstadt zu den westlichen Stadtteilen. Vor allem für den Radverkehr wird ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet und es wird erwartet, dass aufgrund der besseren Anbindung Menschen vermehrt das Fahrrad nutzen werden.
Als konkreter Beitrag zum Klimaschutz beim Bau der Brücke ist die Ausbildung der Fahrbahnplatte mit einem Faserbewehrten Beton zu nennen. Beton verursacht durch die Gewinnung und Herstellung seiner Bestandteile, hier der Abbau von Kies sowie der prozessbedingte Anfall von CO2, eine relativ starke Beanspruchung des Klimas. Wie unter 3.3 dargestellt, kann der Bedarf an Beton für die Fahrbahnplatte um ca. 40 % reduziert werden.
Des Weiteren bestehen Überlegungen, über Anreize in der Vergabe die Firmen dazu zu animieren, klimaneutral hergestellte Baustoffe zu verwenden. Diese Überlegungen sind aber noch nicht abgeschlossen und müssen vergaberechtlich geprüft werden.
8. Archäologie und Denkmalschutz
Der Wasserlauf des Stadtgrabens ist als Teil der ehemaligen Befestigungsanlage der Hansestadt Lübeck unter Schutz gestellt und in das Buch der Bodendenkmale eingetragen.
Unter der Voraussetzung, dass die Baumaßnahmen keine Veränderungen im Uferbereich des Stadtgrabens bewirken werden, wird eine denkmalrechtliche Genehmigung in Aussicht gestellt.
In der Gestaltung (siehe Pkt. 5) wird bewusst auf den möglichst sparsamen Eingriff in das Bodendenkmal eingegangen.
9. Bauzeit und Baudurchführung
Der derzeitige Planungsstand der Stadtgrabenbrücke ist in der Leistungsphase 4 gem. HOAI, also in der Genehmigungsplanung. Es ist vorgesehen, dass bis zum Jahresende 2022 die Genehmigungs- und Ausführungsplanung durchgeführt werden, so dass gegen Ende des Jahres die Ausschreibungsunterlagen erarbeitet werden und die Brücke Anfang nächstes Jahres ausgeschrieben werden kann.
Der Bau der Brücke soll ab dem Frühjahr 2023 erfolgen, es wird von einer Bauzeit von ca. einem Jahr ausgegangen.
Das Bauvorhaben wird von der Hansestadt Lübeck, vertreten durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr, durchgeführt.
10. Baukosten und Finanzierung
Die Herstellungs- und Grunderwerbskosten betragen brutto ca. 4.200.000 EUR
Die Planungs- und Bauleitungskosten betragen ca. 750.000 EUR
Damit ergeben die Gesamtkosten für den Bau der Brücke, 4.950.000 EUR
Die Mittel für 2022 in Höhe von 200.000 EUR sind im lfd. Haushalt geordnet.
Zum Haushalt 2023 wurden bei dem PSK 541001 674.7852000 Auszahlungen von 3.000.000 EUR und bei dem PSK 541001 674.6811000 Einzahlungen von 2.250.000 EUR angemeldet und beschlossen. Für 2024 stehen in der Mittelfristplanung 1.750.000 EUR Auszahlungen und 1.687.500 EUR Einzahlungen zur Verfügung. Damit sind die Gesamtkosten für den Bau der Brücke in Höhe von 4.950.000 EUR berücksichtigt worden.
Eine HU-Bau liegt vor, sodass die Mittel direkt mit Beginn des Haushaltsjahres abgerufen werden können.
Zuschüsse für die Maßnahme wurden sowohl für eine Förderung nach GVFG als auch nach dem „Stadt und Land“-Programm beantragt. Allerdings erscheint nach dem derzeitigen Prüfungsstand die Erlangung einer Förderzusage nicht aussichtsreich. Das GVFG-Programm fördert nach dortiger Aussage nur straßenbegleitende Geh- und Radwege, worum es sich bei der Stadtgrabenbrücke nicht handelt. Es wird noch geprüft, ob die Umfahrung des Lindenplatzes eine mögliche Begründung wäre.
Vom „Stadt und Land“-Programm wurde eine Absage erteilt, weil die Bauzeit der Brücke bis in das Jahr 2024 hineinreicht, die Mittel für das Jahr aber grundsätzlich noch nicht freigegeben sind.
Der Bereich Stadtgrün und Verkehr ist daher bestrebt weitere Fördermöglichkeiten zu aquirieren.
11. Risikomanagement
Der Fachbereich Planen und Bauen hat für Großprojekte ein Risikomanagement eingeführt. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle auf die Vorlage VO/2019/08247 verwiesen.
In einer Übersicht werden alle identifizierten Risiken aufgeführt, bewertet und Gegenmaßnahmen festgelegt. Im Folgenden werden die Risiken erläutert, die als „vorrangiges Risiko“ (rot) für dieses Bauvorhaben bewertet werden.
Die derzeit handlungsrelevanten Risiken werden in der Risikogruppe „Bestand“ und „Finanzen“ gesehen. Sie werden im Folgenden aufgezeigt und die Gegenmaßnahmen dargestellt:
1. | Risiko: | Finanzen – Fehlende Kostensicherheit |
| Ursache: | Derzeitige wirtschaftliche Entwicklung ist nicht abzusehen |
| Auswirkung: | Kostensteigerung |
| Gegenmaßnahme: | Kostenberechnung regelmäßig aktualisieren |
|
|
|
2. | Risiko: | Finanzen – Förderung |
| Ursache: | "Stadt und Land": Beantragtes Förderprogramm hat Absage erteilt, Bauzeit übersteigt den abgesicherten Förderzeitraum. GVFG: Förderzusage steht noch aus, ggf. Förderrichtlinien nicht passend |
| Auswirkung: | Keine Förderzusage |
| Gegenmaßnahme: | weitere Fördermöglichkeiten anfragen |
|
|
|
Anlagen
Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen
Anlage 2: Lageplan
Anlage 3: Visualisierung der Gestaltung
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
| 1 | öffentlich | Anlage 1_Finanzielle Auswirkungen (107 KB) | |||
| 2 | öffentlich | Anlage 2_Lageplan (279 KB) | |||
| 3 | öffentlich | Anlage 3_Visualisierung der Gestaltung (5721 KB) | |||