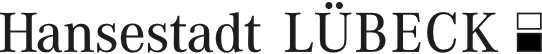- Bürgerservice
- Rathaus
Rathaus
- Rathaus
- Karriereportal
- Politik
- Verwaltung
- Verwaltung
- Antidiskriminierung bei der Hansestadt Lübeck
- Bürgermeisterkanzlei
- Büro der Bürgerschaft
- Feuerwehr
- Finanzen
- Frauenbüro
- Friedhöfe
- Gebäudemanagement
- Gesundheitsamt
- Gesundheitsamt
- Infektionsschutz und Hygiene
- Infektionsschutz und Hygiene
- Übertragbare Krankheiten
- Fragen und Antworten (FAQ)
- Hygieneüberwachung
- Tuberkuloseberatung
- Impfungen
- Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- Zahnärztlicher Dienst
- Amtsärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit
- Weitere Aufgaben
- Ihre Meinung zählt
- Tag der seelischen Gesundheit
- Konzernstruktur
- Kurbetrieb Travemünde
- Lübeck Port Authority
- Ordnungsamt
- Recht
- Soziale Sicherung
- Stabsstelle Migration und Ehrenamt
- Stadtgrün und Verkehr
- Stadtplanung und Bauordnung
- Stadtteilkonferenzen
- Stadtwald
- Standesamt
- Statistik
- Stiftungsverwaltung
- Straßenverkehrsbehörde
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Naturschutz
- Naturschutz
- Schutzgebiete
- Schutzgebiete
- Naturdenkmale flächenhaft
- Naturdenkmale objektbezogen
- Naturdenkmale objektbezogen
- Hängebuche in der Gärtnergasse
- Silberlinde am Koberg
- Ginkgo am Lindenplatz
- Bäume auf dem Jerusalemsberg
- Platanen auf dem Burgtorfriedhof
- Eichen am Waldsaum
- Lindenallee zum Gut Strecknitz
- Eichen- und Lindenallee in Padelügge
- Eichen vor der Schule in Niendorf
- Eichen auf dem Jahnplatz
- Natura 2000-Gebiete
- Geschützte Landschaftsbestandteile
- Naturschutzgebiete
- Landschaftsschutzgebiete
- Arten- und Biotopschutz
- Landschaftsplanung
- Erholung und Natur
- Projekte
- Klima
- Wasser
- Abfall
- Boden
- Lebensmittelüberwachung
- Veterinärwesen
- Gesundheitlicher Umweltschutz
- Hilfe in Notlagen
- Wirtschaft und Liegenschaften
- Wohnraum für Studierende
- Lübeck international
- Stadtleben
Stadtleben
- Stadtleben
- Familie und Bildung
- Familie und Bildung
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Stillfreundliche Stadt
- Beratung und Bildung
- Beratung und Bildung
- Beratung in der Schwangerschaft
- Willkommensbesuche
- Beratungsstellen Frühe Hilfen
- Familienzentren
- Familienzentren
- Familienzentrum / Kita Brüder-Grimm-Ring
- Familienzentrum / Kita Familienkiste
- Familienzentrum / Kita Schaluppenweg
- Familienzentrum / Kita Willy Brandt
- Familienzentrum / Kita St. Bonifatius
- AWO-Familienzentrum / Kita Redderkoppel
- Familienzentrum / Kinderhaus Pellwormstraße
- Familienzentrum / Kita Behaimring
- Familienzentrum / Kita Dreifaltigkeit
- Familienzentrum / Kita Helene Bresslau
- Familienzentrum / Kita Haus Barbara
- AWO-Familienzentrum / Kita Drachennest III
- Familienzentrum / Kita Kinderstube - Travemünde
- Familienzentrum / Kita Sprungtuch e.V. BunteKuh
- Familienzentrum / Kita Beim Meilenstein
- Familienzentrum Kinderhaus Alsheide
- Familienzentrum / Kinderclub
- Familienwegweiser
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen Jugendamt
- Familienbildung
- Telefon-Hotlines
- Beratungsstellen für Familien
- Kindertagesbetreuung
- Jugendamt
- Finanzielle Unterstützung
- Elterngeld/Kindergeld
- Freizeit
- Kinder von 3 - 6
- Kinder von 6 - 12
- Kinder von 6 - 12
- Schule
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Beratung und Unterstützung
- Beratung und Unterstützung
- Finanzielle Unterstützung
- Hilfe und Tipps für Kinder und Jugendliche
- Beratungsstellen für Familien
- Schulpsychologische Beratungsstelle
- Schulsozialarbeit
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen des Jugendamtes
- Telefon-Hotlines
- Familienservice
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Jugendamt
- Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Jugendliche
- Jugendliche
- Schule
- Schule und dann?
- Berufsausbildung
- Studium
- Jugendarbeit
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Jugendamt
- Beratung und Unterstützung
- Kinder- und Jugendbeteiligung
- Weitere Angebote
- Kinder- und Jugendschutz
- Sport
- Erwachsene
- Bildungsplanung
- Tourismus
- Tourismus
- Lübeck
- Travemünde
- Travemünde
- 200 Jahre Ostseebad
- Schiffe gucken
- Sehenswertes in Travemünde
- Strandleben
- Stadtplan Travemünde
- Travemünder Woche
- Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr
- Freizeit
- Freizeit
- LübeckCard
- Mobilität
- Lübecker Schwimmbäder
- Natur erleben
- Grünanlagen und Spielplätze
- Grünanlagen und Spielplätze
- Stadteingänge
- Patenschaften
- Private Feiern im öffentlichen Grün
- Grillen in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Baum des Jahres
- Baum des Jahres
- Stiel-Eiche
- Rot-Buche
- Sommer-Linde
- Berg-Ulme
- Speierling
- Gewöhnliche Eibe
- Spitz-Ahorn
- Hainbuche
- Eberesche
- Wild-Birne
- Silber-Weide
- Sandbirke
- Gewöhnliche Esche
- Gewöhnlicher Wacholder
- Schwarz-Erle
- Weiß-Tanne
- Rosskastanie
- Schwarz-Pappel
- Wald-Kiefer
- Walnuss
- Berg-Ahorn
- Vogel-Kirsche
- Elsbeere
- Europäische Lärche
- Wild-Apfel
- Trauben-Eiche
- Feld-Ahorn
- Winter-Linde
- Fichte
- Esskastanie
- Flatterulme
- Robinie
- Stechpalme
- Rot-Buche
- Moor-Birke
- Mehlbeere
- Roteiche
- Karte Baum des Jahres
- Schnullerbaum
- Baumkataster
- Klimabäume
- Baumspende
- Habitatbäume
- Anders parken – Bäume schützen
- Grün- und Parkanlagen
- Stadtnahe Erholung
- Spielen in der Stadt
- Sport
- Wochenmärkte
- Weihnachtsmärkte
- Schwimm- und Badegewässer
- Laternenumzug
- Kultur
- Kultur
- Museen
- Museen
- Museum Holstentor
- Buddenbrookhaus
- Günter Grass-Haus
- Kunsthalle St. Annen
- Museum Behnhaus Drägerhaus
- Willy-Brandt-Haus
- Museum für Natur und Umwelt
- KOLK 17 Figurentheater & Museum
- Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk
- Grenzmuseum
- Europäisches Hansemuseum
- Katharinenkirche
- St. Annen-Museum
- Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck
- Niederegger Marzipansalon
- Museum Alter Leuchtturm Travemünde
- Overbeck-Gesellschaft
- Museum Haus Hansestadt Danzig
- Theater
- Musik- & Kongresshalle
- Schleswig-Holstein Musik Festival
- Nordische Filmtage Lübeck
- Musikhochschule
- Bibliothek der Hansestadt Lübeck
- Stadtarchiv
- Kulturbüro
- Historische Pflaster
- Archäologie und Denkmalpflege
- Stolpersteine
- Galerien
- Filmstadt Lübeck
- Gedenkstätte Lübecker Märtyrer
- Wissenschaftspfad
- Kolosseum Lübeck
- Wohnen in Lübeck
- Veranstaltungen
- Stadtentwicklung
Stadtentwicklung
- Stadtentwicklung
- Lärmschutz
- Radverkehr
- Klima
- Klima
- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel
- Nachhaltigkeit
- Klimafonds
- Smart City Lübeck
- Smart City Lübeck
- Smart City Family
- Projekte und Maßnahmen
- Wir digital für Lübeck
- Digitale Strategie
- Smart City Infrastruktur
- Beteiligung
- überMORGEN
- überMORGEN
- Stadtentwicklungsdialog
- Rahmenplan und Mobilitätskonzept Innenstadt
- Verkehrsentwicklungsplan
- Stadtteilveranstaltungen
- Flächennutzungsplan
- Radverkehrskonzept
- Hafenentwicklungsplan
- Touristisches Entwicklungskonzept
- Kommunales Integrationskonzept
- Umfrage Klimaschutzmaßnahmen für 2021
- Masterplan Klimaschutz
- Übergangsweise
- Wirtschaftsförderung
- Priwall-Promenade
- Stadtplanung
- Stadtplanung
- Einzelhandelskonzepte
- Gewerbeflächen
- Wohnungsmarktberichte
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Verkehrskonzepte / ÖPNV
- Lübeck 2030
- Aktuelle Wohnbauprojekte
- Wohnquartier Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld
- Gründungsviertel
- Bauleitplanung
- Städtebauförderung
- Infrastruktur
- Stadtbildpflege
- Verkehrsmanagementsystem
- Hafen Lübeck
- Sportentwicklung
- Fehmarnbeltquerung
- Presse
Vorlage - VO/2019/07438
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag
Im Herbst 2019 soll die 3. Autofähre für die Verbindung Travemünde-Priwall ausgeschrieben werden.
Es stellt sich die Frage, ob es insbesondere unter Kosten-Nutzen-Erwägungen Sinn machen könnte, die Ausschreibung der Autofähre dahingehend zu ändern, dass statt einer konventionellen Fähre eine Multifunktionsfähre ausgeschrieben wird. Als Vorbild könnte die 2018 in Dienst gestellte Fähre MARY ROOS dienen, die zwischen Rüdesheim und Bingen im Einsatz ist. Der Anforderungskatalog / die Anforderungsspezifikation im Lastenheft müsste entsprechend angepasst werden. Wie steht die Verwaltung zu diesem Vorschlag?
Begründung
Gegenstand:
Aktuell wird die Ausschreibung der 3. Autofähre vorbereitet. Ausgeschrieben werden soll eine konventionelle Autofähre. Das macht Sinn. Das steht auch außer Frage.
Sinn machen könnte es auch bereits bei der Konstruktion unterschiedliche Zusatzver-wendungen vorzusehen. Diese könnten neben einem Zusatznutzen, zusätzlichen Einnahmen in einigen Fällen auch Einsparungen an anderer Stelle bedeuten. Werden entsprechende Überlegungen bereits in der Konstruktionsphase berücksichtigt, erübrigen sich später teure Umbauten und damit Mehrkosten.
Rein äußerlich unterscheidet sich eine Multifunktionsfähre unwesentlich von einer konventionellen Fähre. Es sind die „innen Werte“, die den Unterschied ausmachen. Die spezielle Technik einer Fähre erlaubt viele Zusatzverwendungen. Der bereits bei den Bestandsfähren PÖTENITZ und TRAVEMÜNDE eingesetzte Voith-Schneider-Antrieb erlaubt präzises Manövrieren und Drehen „auf dem Bierdeckel“.
1.. Hauptverwendung als konventionelle Fähre
Die Verwendung als konventionelle Fähre soll nach wie vor den Großteil der Nutzungen ausmachen.
2.. Zusatzverwendung als Einsatzboot zur Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Schiffsbrände und Schiffshavarieren sind seltene, aber nicht auszuschließende Ernstfälle. Im zweitgrößten deutschen Ostseehafen gibt es viele Schiffsbewegungen und damit entsprechendes Gefährdungspotential. Die Kollision der NILS HOLGERSSON mit der URD, die Großbrände auf dem Schrottplatz in Kücknitz oder auf dem O&K-Gelände in der Einsiedelstraße haben die Notwendigkeit eines Feuerlöschbootes gezeigt. Neben Schiffsbränden und Schiffskollisionen zählen Brände im ufernahen, aber landseitig nicht oder nur schlecht zugänglichen Bereich, Gefahrstoffaustritte sowie technische Hilfeleistungen zu den Szenarien, für die ein Löschboot benötigt wird. Wann immer etwas an und auf dem Wasser passiert kommt es auf schnelles, koordiniertes Eingreifen der Einsatzkräfte an.
Bislang stand für derartige Einsätze das in Schlutup stationierte Feuerlöschboot SENATOR EMIL PETERS bereit. Doch die Tage des 1972 in Dienst gestellten Feuerlöschbootes sind gezählt. Als Einsatzmittel gilt es als überholt. Aus einsatztaktischer Sicht entspricht es nicht mehr den heutigen Anforderungen zur Gefahrenabwehr auf Gewässern. Nachdem eine Modernisierung wenig sinnvoll, auch wirtschaftlich nicht vertretbar war beschloss die Bürgerschaft 2017 eine Ersatzbeschaffung. Die EMIL PETERS sollte durch ein Hilfeleistungslöschboot ersetzt werden. Bislang blieb es beim Beschluss.
Feuerlöschboot EMIL PETERS ist also nach wie vor 1. Wahl als Einsatzboot. Nicht immer ist es jedoch verfügbar. Notwendige Werftaufenthalte machen Ersatzeinsatzkonzepte erforderlich. Für Notfälle kommt bei Verfügbarkeit der seit Juli 2018 in Travemünde beheimatete und mit 2 Löschmonitoren ausgestattete Schlepper ARGUS in Frage. ARGUS kann allerdings nicht alle Aufgaben (Schleppen und Brandbekämpfung) gleichzeitig bewältigen und ist zudem aufgrund seines Tiefgangs nur im Tiefwasserbereich der Trave einsatzfähig. Nicht in Travemünde wohl aber in Grömitz hält die DGzRS einen Seenotrettungskreuzer mit Feuerlöschanlage vor. Dieser könnte im Rahmen der Amtshilfe angefordert werden. Seine Marschzeit von dort zum Skandinavien-Kai beträgt allerdings 90 Minuten.
Wesentlich schneller könnten die Fähren des Stadtverkehrs am Skandinavien-Kai sein, die sich v.A. als Unterstützungsalternative anbieten. Die Fähren sind im Konzept zur Sicherstellung des Brandschutzes und der rettungsdienstlichen Versorgung auf dem Priwall eingebunden und können nach Absprache mit dem Stadtverkehr auch für wasserseitige Brandbekämpfungsmaßnahmen eingesetzt werden. Unmittelbar nach der Alarmierung wäre es möglich geeignete Einsatzfahrzeuge, insbesondere ein Großtanklöschfahrzeug mit Schaum-Wasser-Werfer (TLF 24/50) an Bord zu nehmen.
Für die Fähren spricht, dass sie in Sichtweite des Skandinavien-Kais stationiert sind und im Alarmfall in der Kernzeit von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr ad hoc zur Verfügung stehen können. Dies kann bei Erstmaßnahmen der Brandbekämpfung einen entscheidenden Zeitvorteil bedeuten und die Zeit überbrücken helfen bis leistungsfähigere Einsatzmittel den Einsatzort erreichen.
Fähren können aber niemals als Ersatz, sondern maximal in Ergänzung und Unterstützung eines Feuerlöschbootes oder anderer Einsatzmittel zum Einsatz kommen. Dies insbesondere dann, wenn es darum geht einen Brandherd von mehreren Seiten zu bekämpfen, eine Bordwand zu kühlen oder auch Pumpleistung bereit zu halten um vollgelaufene Schiffe zu lenzen.
Erforderliche Zusatzausstattung / Erforderliche Maßnahmen
Die Zusatzverwendung als Einsatzboot zur Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr erfordert grundsätzlich keinerlei Umbauten. Alle benötigten Einsatzmittel können im Bedarfsfall an Bord gebracht werden. Wenig würde auf die spezielle Verwendungsoption hindeuten.
Die Einsatztauglichkeit ließe sich erheblich verbessern, wenn Löschmonitore, idealerweise am Teleskopmast eingebaut würden, um zielgenaue Löschangriffe auch bei größeren Schiffen in Höhen von bis zu 20 m ausführen zu können. Die Wasser- bzw. Schaumversorgung könnte über leistungsfähige Pumpen im Löschfahrzeug oder über externe Pumpen erfolgen. Weitere denkbare Optionen wären ein Teleskoplichtmast, Suchscheinwerfer sowie Zusatzkameras auf dem Fährdeck sowie außerbords.
Die Motorisierung, das Bordnetz und die Navigationseinrichtungen sollten an die Zusatzverwendung angepasst werden. Tiefenmesser sind für Fähren sekundär, für freifahrende Schiffe im Niedrigwasserbereich aber notwendig. Dort könnten auch Stoßbügel zum Schutz der Antriebseinheit sinnvoll sein.
Bereits bei der Konstruktion sollten Zusatzverwendungen im Rahmen von Berechnungen zur Statik oder Trimmung berücksichtigt werden. Verstärkungen, Stützen oder veränderte Positionen einzelner Baugruppen lassen sich in der Konstruktionsphase leicht einarbeiten. Spätere Umbauten sind dagegen aufwendig, teuer und häufig aufgrund der Komplexität nur schwer zu realisieren.
Mehrwert:
Die Zusatzverwendung bedeutet einen Mehrwert. Die Brandbekämpfung und Gefahrenab-wehr im Hafen erfährt eine Verbesserung. Einsatzmittel können noch flexibler gewählt werden. Die Option den Einsatzort schneller erreichen zu können als andere Einsatzmittel kann lebensrettend sein. Eine Umsetzung ist bei vergleichsweise niedrigen Zusatzkosten möglich. Zudem besteht die Option auf Vergütung / Erstattung für das Bereithalten bzw. zur Verfügungsstellen im Einzelfall.
Zusatzkosten der Verwendungsoption
Die Verwendungsoption ist mit zusätzlichen Kosten verbunden. Diese halten sich jedoch im Rahmen, wenn man sie an der Gesamtinvestition misst. Der Mehrwert überwiegt die Mehrkosten bei weitem.
3.. Zusatzverwendung als charterbare Arbeits-, Transport- und Beobachtungsplattform
Die Nähe der Fähre zum Skandinavien-Kai und zu weiteren Hafenanlagen eröffnet die Möglichkeit sie auch als Arbeits-, Transport- und Beobachtungsplattform zu verchartern.
Erforderliche Zusatzausstattung / Erforderliche Maßnahmen
Die Zusatzverwendung als charterbare Arbeits-,Transport- und Beobachtungsplattform erfordert grundsätzlich keine Umbauten. Die oben zum Einsatzboot zur Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr gemachten Anmerkungen gelten auch hier. Notwendig wäre ein Konzept für das Verchartern.
Mehrwert
Der Mehrwert resultiert vor allem aus den Mehreinnahmen der Vercharterung.
Zusatzkosten der Verwendungsoption
Die Verwendungsoption ist mit keinen nennenswerten zusätzlichen Kosten verbunden.
4.. Zusatzverwendung als charterbares Eventschiff
Weitere Verwendungsoptionen würde die Zulassung als Fahrgastschiff eröffnen. Bei der Autofähre MARY ROOS wurde eine solche Zulassung beantragt und nach Umsetzung einiger Vorgaben auch erworben. Seit 2018 ist die Fähre als modernste ihrer Art zwischen Bingen u Rüdesheim im Einsatz.
Ein solches Geschäftsmodell würde sich in Randzeiten auch bei der neuen Priwallfähre anbieten. Im Chartergeschäft könnte die Fähre nicht nur quer über, sondern auch längs auf der Trave unterwegs sein. Das Fahrzeugdeck würde zur Event-Plattform, zur schwimmenden Tanzfläche oder zur Bühne. Auf dem Fahrzeugdeck ließen sich kurzfristig ein Zelt oder eine Bühne errichten. Die trendigen Food-Trucks stellen ein mobiles Catering sicher. Außergewöhnliche Feste und Veranstaltungen wären möglich: Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen, Betriebsfeste, Vereins- oder Weihnachtsfeiern. – einzigartig und individuell. Denkbar wären Produktpräsentationen, Modeschauen, der Tanz in den Mai, Techno-Partys oder ein schwimmender Weihnachtsmarkt. Ebenfalls denkbar wären Begleitfahrten bei Groß- Veranstaltungen z.B. Regatten im Rahmen der Travemünder Woche oder spektakuläre Kreuzfahrtschiffanläufe (QUEEN ELIZABETH). Auch das Silvesterfeuerwerk könnte auf der Fähre erlebt werden.
Erforderliche Zusatzausstattung / Erforderliche Maßnahmen
Die Zusatzverwendung als Eventschiff setzt zwingend die Zulassung als Fahrgastschiff voraus. Hierzu muss die Fähre wie ein Ausflugsschiff ausgestattet sein und bestimmte Auflagen erfüllen. Die MARY ROOS bekam die Zulassung als Fahrgastschiff nachdem die Zahl der Schwimmwesten erhöht, ein Zusatzanker nachgewiesen sowie eine größere Toilettenanlage eingebaut wurde. Zudem bestanden die offiziellen Stellen auf einem drehbaren Steuerstuhl, damit der Schiffsführer in Fahrtrichtung sitzen kann. Der Aufbau wurde aus Brandschutzgründen ein wenig angepasst. Insgesamt keine unlösbaren Aufgaben. Bei der MARY ROOS hat man es gemacht. Warum nicht auch bei der neuen Priwall-Fähre?
Größere Umbauten sind nicht erforderlich. Ein leistungsfähiges Bordnetz sollte vorhanden und zusätzliche Maßnahmen, die ein ungewolltes Überbordgehen verhindern können, angedacht werden. Darüber hinaus gelten die oben gemachten Anmerkungen. Auf diese Verwendungsoption wird rein äußerlich wenig hinweisen.
Mehrwert:
Auch diese Zusatzverwendung bedeutet einen Mehrwert. Durch das Chartergeschäft in Randzeiten können zusätzliche Einnahmen generiert werden. Mit der Fähre ist ein Imagegewinn verbunden. Für Veranstalter, Investoren und die Gastronomie ergeben sich neue Optionen. Travemünde würde um eine Attraktion reicher. Zudem lassen sich lärmintensive Veranstaltungsformate in wenigen Minuten dorthin verlegen, wo sie weniger stören. Dies eröffnet insbesondere bei der Travemünder Woche völlig neue Möglichkeiten. Und dies bei größtmöglichem Spaß für all jene, die an Bord sind.
Zusatzkosten der Verwendungsoption
Die Verwendungsoption ist mit zusätzlichen Kosten verbunden. Diese halten sich jedoch im Rahmen, wenn man sie an der Gesamtinvestition misst. Der Mehrwert überwiegt die Mehrkosten bei weitem.
Hintergrund:
Die Fährverbindung Travemünde – Priwall mit den Doppelendfähren PÖTENITZ und TRAVEMÜNDE
Die Fährverbindung über die Trave bei Travemünde gehört zu den ältesten Schiffsverbindungen in Norddeutschland. Entsprechende Hinweise lassen sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Während im 13. Jahrhundert noch Kähne den Fährdienst auf den Priwall sicherstellten, sind es aktuell die Auto-fähren TRAVEMÜNDE und PÖTENITZ, mit der Reserve BERLIN sowie an der Nordermole die PRIVALL VI mit der Reserve PRIWALL IV. Während an der Nordermole 200.000 Fußgänger und Radfahrer jährlich übersetzten, sind es bei der Autofähre 3 Mio Fahrgäste und 1 Mio Fahrzeuge. 1999 wurden 5 Mio Fahrgäste und 1,4 Mio Autos transportiert. Zu Hauptverkehrszeiten werden beide Fähren eingesetzt.
Die Doppelendfähren TRAVEMÜNDE und PÖTENITZ wurden im März bzw. Mai 1999 in Betrieb genommen. Sie wurden bei der Flender Werft AG in Lübeck gebaut und kosteten jeweils 4 Mio. Mark. Die Fähren sind 37,00 m lang, 13,50 m breit und haben einen Tiefgang von 1,30 m. Die Länge über Deck beträgt 32,00 m. Die Zuladung beträgt 120 t, die Achslast bis zu 20 t. Maximal 18 PKW bzw. 12 PKW plus 2 LKW á 45 t werden transportiert. Der Hauptantrieb erfolgt über 2 IVECO Diesel- Motoren mit 367 KW. Die Motorleistung wird durch Getriebe auf 2 Voith Schneider Propeller übertragen.
Die Fährverbindung Bingen – Rüdesheim als Reverenz mit der Doppelendfähre MARY ROOS
Ebenfalls bis ins Mittelalter lassen sich Hinweise zur Fährverbindung zwischen Bingen und Rüdesheim zurückverfolgen. 2018 wurde auf der Fährverbindung die modernste Autofähre am Rhein in Dienst gestellt. Die Besonderheit liegt in der Zulassung als Fahrgastschiff begründet. Sie ist wie ein Ausflugsschiff ausgerüstet. Die „Mary Roos“ wurde in der Lux-Werft in Mondorf bei Bonn gebaut. Sie hat eine Länge von 57,00 m, eine Breite von 17,00 m und einen Tiefgang von 1,25 m. Die Fähre ist 330 t schwer. Die Zuladung liegt bei 200 t. Die Kapazität liegt bei 42 PKW und 600 Personen. Der Hauptantrieb erfolgt über 2 Volvo Penta Dieselmotoren mit jeweils 280 KW.
Anmerkungen zum Antriebskonzept und dem Antrieb der Priwallfähre:
Die Priwallfähren werden bislang mit Diesel betrieben. Es wäre zu prüfen, ob ein Elektroantrieb eine Alternative sein könnte. In Europa werden bereits erste Fähren mit Elektroantrieb ausgestattet. Vorreiter sind Norweger, Finnen und seit 2017 auch Deutsche mit der Fähre an der Mosel (Wasserbillig). Dort wird der Batteriepack über Solarmodule auf dem Fährdach, nachts über Landanschluss gespeist. Konzeptionell haben die Norweger die Nase vorn. Zum einen können sie nachhaltig erzeugten Öko-Strom aus ihren Wasserkraftwerken verwenden. Zum anderen sind ihre Fahrpläne weniger engmaschig. In Travemünde wechselt sie alle 15 Min auf die andere Traveseite. Da bleibt kaum Zeit zum „An- und Abstöpseln“ des Landanschlusses. Im Hinblick auf das Antriebskonzept spricht vieles dafür das Konzept der Bestandfähren zu übernehmen. Der Voith-Schneider-Antrieb (VSA) hat sich bewährt.
Anlagen