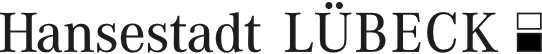- Bürgerservice
- Rathaus
Rathaus
- Rathaus
- Karriereportal
- Politik
- Verwaltung
- Verwaltung
- Antidiskriminierung bei der Hansestadt Lübeck
- Bürgermeisterkanzlei
- Büro der Bürgerschaft
- Feuerwehr
- Finanzen
- Frauenbüro
- Friedhöfe
- Gebäudemanagement
- Gesundheitsamt
- Gesundheitsamt
- Infektionsschutz und Hygiene
- Infektionsschutz und Hygiene
- Übertragbare Krankheiten
- Fragen und Antworten (FAQ)
- Hygieneüberwachung
- Tuberkuloseberatung
- Impfungen
- Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- Zahnärztlicher Dienst
- Amtsärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit
- Weitere Aufgaben
- Ihre Meinung zählt
- Tag der seelischen Gesundheit
- Konzernstruktur
- Kurbetrieb Travemünde
- Lübeck Port Authority
- Ordnungsamt
- Recht
- Soziale Sicherung
- Stabsstelle Migration und Ehrenamt
- Stadtgrün und Verkehr
- Stadtplanung und Bauordnung
- Stadtteilkonferenzen
- Stadtwald
- Standesamt
- Statistik
- Stiftungsverwaltung
- Straßenverkehrsbehörde
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Naturschutz
- Naturschutz
- Schutzgebiete
- Schutzgebiete
- Naturdenkmale flächenhaft
- Naturdenkmale objektbezogen
- Naturdenkmale objektbezogen
- Hängebuche in der Gärtnergasse
- Silberlinde am Koberg
- Ginkgo am Lindenplatz
- Bäume auf dem Jerusalemsberg
- Platanen auf dem Burgtorfriedhof
- Eichen am Waldsaum
- Lindenallee zum Gut Strecknitz
- Eichen- und Lindenallee in Padelügge
- Eichen vor der Schule in Niendorf
- Eichen auf dem Jahnplatz
- Natura 2000-Gebiete
- Geschützte Landschaftsbestandteile
- Naturschutzgebiete
- Landschaftsschutzgebiete
- Arten- und Biotopschutz
- Landschaftsplanung
- Erholung und Natur
- Projekte
- Klima
- Wasser
- Abfall
- Boden
- Lebensmittelüberwachung
- Veterinärwesen
- Gesundheitlicher Umweltschutz
- Hilfe in Notlagen
- Wirtschaft und Liegenschaften
- Wohnraum für Studierende
- Lübeck international
- Stadtleben
Stadtleben
- Stadtleben
- Familie und Bildung
- Familie und Bildung
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Stillfreundliche Stadt
- Beratung und Bildung
- Beratung und Bildung
- Beratung in der Schwangerschaft
- Willkommensbesuche
- Beratungsstellen Frühe Hilfen
- Familienzentren
- Familienzentren
- Familienzentrum / Kita Brüder-Grimm-Ring
- Familienzentrum / Kita Familienkiste
- Familienzentrum / Kita Schaluppenweg
- Familienzentrum / Kita Willy Brandt
- Familienzentrum / Kita St. Bonifatius
- AWO-Familienzentrum / Kita Redderkoppel
- Familienzentrum / Kinderhaus Pellwormstraße
- Familienzentrum / Kita Behaimring
- Familienzentrum / Kita Dreifaltigkeit
- Familienzentrum / Kita Helene Bresslau
- Familienzentrum / Kita Haus Barbara
- AWO-Familienzentrum / Kita Drachennest III
- Familienzentrum / Kita Kinderstube - Travemünde
- Familienzentrum / Kita Sprungtuch e.V. BunteKuh
- Familienzentrum / Kita Beim Meilenstein
- Familienzentrum Kinderhaus Alsheide
- Familienzentrum / Kinderclub
- Familienwegweiser
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen Jugendamt
- Familienbildung
- Telefon-Hotlines
- Beratungsstellen für Familien
- Kindertagesbetreuung
- Jugendamt
- Finanzielle Unterstützung
- Elterngeld/Kindergeld
- Freizeit
- Kinder von 3 - 6
- Kinder von 6 - 12
- Kinder von 6 - 12
- Schule
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Beratung und Unterstützung
- Beratung und Unterstützung
- Finanzielle Unterstützung
- Hilfe und Tipps für Kinder und Jugendliche
- Beratungsstellen für Familien
- Schulpsychologische Beratungsstelle
- Schulsozialarbeit
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen des Jugendamtes
- Telefon-Hotlines
- Familienservice
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Jugendamt
- Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Jugendliche
- Jugendliche
- Schule
- Schule und dann?
- Berufsausbildung
- Studium
- Jugendarbeit
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Jugendamt
- Beratung und Unterstützung
- Kinder- und Jugendbeteiligung
- Weitere Angebote
- Kinder- und Jugendschutz
- Sport
- Erwachsene
- Bildungsplanung
- Tourismus
- Tourismus
- Lübeck
- Travemünde
- Travemünde
- 200 Jahre Ostseebad
- Schiffe gucken
- Sehenswertes in Travemünde
- Strandleben
- Stadtplan Travemünde
- Travemünder Woche
- Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr
- Freizeit
- Freizeit
- LübeckCard
- Mobilität
- Lübecker Schwimmbäder
- Natur erleben
- Grünanlagen und Spielplätze
- Grünanlagen und Spielplätze
- Stadteingänge
- Patenschaften
- Private Feiern im öffentlichen Grün
- Grillen in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Baum des Jahres
- Baum des Jahres
- Stiel-Eiche
- Rot-Buche
- Sommer-Linde
- Berg-Ulme
- Speierling
- Gewöhnliche Eibe
- Spitz-Ahorn
- Hainbuche
- Eberesche
- Wild-Birne
- Silber-Weide
- Sandbirke
- Gewöhnliche Esche
- Gewöhnlicher Wacholder
- Schwarz-Erle
- Weiß-Tanne
- Rosskastanie
- Schwarz-Pappel
- Wald-Kiefer
- Walnuss
- Berg-Ahorn
- Vogel-Kirsche
- Elsbeere
- Europäische Lärche
- Wild-Apfel
- Trauben-Eiche
- Feld-Ahorn
- Winter-Linde
- Fichte
- Esskastanie
- Flatterulme
- Robinie
- Stechpalme
- Rot-Buche
- Moor-Birke
- Mehlbeere
- Roteiche
- Karte Baum des Jahres
- Schnullerbaum
- Baumkataster
- Klimabäume
- Baumspende
- Habitatbäume
- Anders parken – Bäume schützen
- Grün- und Parkanlagen
- Stadtnahe Erholung
- Spielen in der Stadt
- Sport
- Wochenmärkte
- Weihnachtsmärkte
- Schwimm- und Badegewässer
- Laternenumzug
- Kultur
- Kultur
- Museen
- Museen
- Museum Holstentor
- Buddenbrookhaus
- Günter Grass-Haus
- Kunsthalle St. Annen
- Museum Behnhaus Drägerhaus
- Willy-Brandt-Haus
- Museum für Natur und Umwelt
- KOLK 17 Figurentheater & Museum
- Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk
- Grenzmuseum
- Europäisches Hansemuseum
- Katharinenkirche
- St. Annen-Museum
- Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck
- Niederegger Marzipansalon
- Museum Alter Leuchtturm Travemünde
- Overbeck-Gesellschaft
- Museum Haus Hansestadt Danzig
- Theater
- Musik- & Kongresshalle
- Schleswig-Holstein Musik Festival
- Nordische Filmtage Lübeck
- Musikhochschule
- Bibliothek der Hansestadt Lübeck
- Stadtarchiv
- Kulturbüro
- Historische Pflaster
- Archäologie und Denkmalpflege
- Stolpersteine
- Galerien
- Filmstadt Lübeck
- Gedenkstätte Lübecker Märtyrer
- Wissenschaftspfad
- Kolosseum Lübeck
- Wohnen in Lübeck
- Veranstaltungen
- Stadtentwicklung
Stadtentwicklung
- Stadtentwicklung
- Lärmschutz
- Radverkehr
- Klima
- Klima
- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel
- Nachhaltigkeit
- Klimafonds
- Smart City Lübeck
- Smart City Lübeck
- Smart City Family
- Projekte und Maßnahmen
- Wir digital für Lübeck
- Digitale Strategie
- Smart City Infrastruktur
- Beteiligung
- überMORGEN
- überMORGEN
- Stadtentwicklungsdialog
- Rahmenplan und Mobilitätskonzept Innenstadt
- Verkehrsentwicklungsplan
- Stadtteilveranstaltungen
- Flächennutzungsplan
- Radverkehrskonzept
- Hafenentwicklungsplan
- Touristisches Entwicklungskonzept
- Kommunales Integrationskonzept
- Umfrage Klimaschutzmaßnahmen für 2021
- Masterplan Klimaschutz
- Übergangsweise
- Wirtschaftsförderung
- Priwall-Promenade
- Stadtplanung
- Stadtplanung
- Einzelhandelskonzepte
- Gewerbeflächen
- Wohnungsmarktberichte
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Verkehrskonzepte / ÖPNV
- Lübeck 2030
- Aktuelle Wohnbauprojekte
- Wohnquartier Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld
- Gründungsviertel
- Bauleitplanung
- Städtebauförderung
- Infrastruktur
- Stadtbildpflege
- Verkehrsmanagementsystem
- Hafen Lübeck
- Sportentwicklung
- Fehmarnbeltquerung
- Presse
Vorlage - VO/2019/06980
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag
Begründung
Die Anfrage von BM Dr. Eymer zu den Konsequenzen der anstehenden Grundsteuerreform für die Hansestadt Lübeck und für die Bürgerinnen und Bürger wird wie folgt beantwortet:
Bei der Erhebung der Grundsteuer gilt aktuell eine Aufgabenteilung zwischen den Finanzämtern und den zuständigen Kommunen. Die Finanzämter ermitteln nach dem Bewertungsgesetz einen Einheitswert für jedes Grundstück. Anhand dieses Einheitswertes wird dann durch die Finanzämter ein Grundsteuermessbetrag festgesetzt, welcher den Kommunen mitgeteilt wird. Die Kommunen wenden auf diesem Messbetrag ihren durch die die Gemeindevertretung beschlossen Hebesatz an und errechnen so die festzusetzende Grundsteuer.
Einheitswert x Messzahl = Messbetrag Zuständigkeit Finanzamt
Messbetrag x Hebesatz = Grundsteuer Zuständigkeit Kommunen
Das Bundesverfassungsgericht hat nunmehr am 10. April 2018 entschieden, dass die Regelungen für die Ermittlungen des Einheitswertes veraltet und daher nicht mehr verfassungsgemäß sind. Dies beruht auf dem Umstand, dass das Festhalten des Gesetzgebers an den Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 zu gravierenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen führt. Der Gesetzgeber wurde demnach vom Bundesverfassungsgericht aufgefordert spätestens bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung für die Bewertungsvorschriften zu finden. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31.12.2024 angewandt werden.
Das Bundesfinanzministerium hat am 29.11.2018 zwei mögliche Reformmodelle vorgestellt, die lt. Pressemitteilung im Januar 2019 mit den Ländern erörtert werden sollen. Die Inhalte zu den einzelnen Modellen sind als Anlage 1 und 2 beigefügt. Das durch das Grundgesetz geregelte Hebesatzrecht der Kommunen soll in beiden Modellen beibehalten werden.
Ein grundsätzliches Thema in der Diskussion zur Reform der Grundsteuer ist die Aufkommensneutralität. Beim Wertunabhängigen Modell (WUM / Anlage 1) soll dies durch ein Messbetragsvolumen erreicht werden, welches dem heutigen in etwa entspricht. Da dieses sich jedoch an der Höhe des bundesweit bestehenden Volumens orientiert, ist eine zusätzliche Korrektur durch eine Hebesatzanpassung der einzelnen Kommunen erforderlich. Auch ist in diesem Modell vorgesehen, dass die Länder die Erhebung der Grundsteuer vollständig an die Kommunen übertragen können.
Das Wertabhängige Modell (WAM / Anlage 2) setzt darauf, dass die Kommunen anhand der durch die Finanzämter ermittelten Messbeträge die örtlichen Hebesätze anpasst und somit innerhalb einer Kommune eine Aufkommensneutralität sichergestellt ist. Hier ist keine Veränderung der bisherigen Zuständigkeitsregelungen vorgesehen.
Grundsätzlich ist anzumerken, dass zwar Instrumente zur Aufkommensneutralität innerhalb einer Kommune vorliegen, jedoch wird dieses nicht zwingend für den einzelnen Grundsteuerpflichtigen gelten. Es wird vermutlich eine hohe Anzahl von Pflichtigen geben, bei denen sich die Grundsteuer nur sehr geringfügig ändern wird. Ein Teil der Pflichtigen wird aber auch merklich mehr oder auch weniger Grundsteuer zahlen müssen. Eine Aussage zur Anzahl der Betroffenen und der monetären Auswirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden.
Der für die Erhebung zuständige Bereich begleitet die Entwicklungen der Grundsteuerreform und wird sich bei Bedarf durch Stellungnahmen über den Städteverband und Städtetag einbringen.
Anlagen
Anlage 1 – Wertunabhängiges Modell (WUM)
Anlage 2 – Wertabhängiges Modell (WAM)
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
| 1 | öffentlich | Grundsteuerreform Modell 1 153-2018-1 (173 KB) | |||
| 2 | öffentlich | Grundsteuerreform Modell 2 153-2018-2 (309 KB) | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||