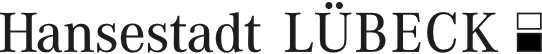- Bürgerservice
- Rathaus
Rathaus
- Rathaus
- Karriereportal
- Politik
- Verwaltung
- Verwaltung
- Antidiskriminierung bei der Hansestadt Lübeck
- Bürgermeisterkanzlei
- Büro der Bürgerschaft
- Feuerwehr
- Finanzen
- Frauenbüro
- Friedhöfe
- Gebäudemanagement
- Gesundheitsamt
- Gesundheitsamt
- Infektionsschutz und Hygiene
- Infektionsschutz und Hygiene
- Übertragbare Krankheiten
- Fragen und Antworten (FAQ)
- Hygieneüberwachung
- Tuberkuloseberatung
- Impfungen
- Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- Zahnärztlicher Dienst
- Amtsärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit
- Weitere Aufgaben
- Ihre Meinung zählt
- Tag der seelischen Gesundheit
- Konzernstruktur
- Kurbetrieb Travemünde
- Lübeck Port Authority
- Ordnungsamt
- Recht
- Soziale Sicherung
- Stabsstelle Migration und Ehrenamt
- Stadtgrün und Verkehr
- Stadtplanung und Bauordnung
- Stadtteilkonferenzen
- Stadtwald
- Standesamt
- Statistik
- Stiftungsverwaltung
- Straßenverkehrsbehörde
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Naturschutz
- Naturschutz
- Schutzgebiete
- Schutzgebiete
- Naturdenkmale flächenhaft
- Naturdenkmale objektbezogen
- Naturdenkmale objektbezogen
- Hängebuche in der Gärtnergasse
- Silberlinde am Koberg
- Ginkgo am Lindenplatz
- Bäume auf dem Jerusalemsberg
- Platanen auf dem Burgtorfriedhof
- Eichen am Waldsaum
- Lindenallee zum Gut Strecknitz
- Eichen- und Lindenallee in Padelügge
- Eichen vor der Schule in Niendorf
- Eichen auf dem Jahnplatz
- Natura 2000-Gebiete
- Geschützte Landschaftsbestandteile
- Naturschutzgebiete
- Landschaftsschutzgebiete
- Arten- und Biotopschutz
- Landschaftsplanung
- Erholung und Natur
- Projekte
- Klima
- Wasser
- Abfall
- Boden
- Lebensmittelüberwachung
- Veterinärwesen
- Gesundheitlicher Umweltschutz
- Hilfe in Notlagen
- Wirtschaft und Liegenschaften
- Wohnraum für Studierende
- Lübeck international
- Stadtleben
Stadtleben
- Stadtleben
- Familie und Bildung
- Familie und Bildung
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Stillfreundliche Stadt
- Beratung und Bildung
- Beratung und Bildung
- Beratung in der Schwangerschaft
- Willkommensbesuche
- Beratungsstellen Frühe Hilfen
- Familienzentren
- Familienzentren
- Familienzentrum / Kita Brüder-Grimm-Ring
- Familienzentrum / Kita Familienkiste
- Familienzentrum / Kita Schaluppenweg
- Familienzentrum / Kita Willy Brandt
- Familienzentrum / Kita St. Bonifatius
- AWO-Familienzentrum / Kita Redderkoppel
- Familienzentrum / Kinderhaus Pellwormstraße
- Familienzentrum / Kita Behaimring
- Familienzentrum / Kita Dreifaltigkeit
- Familienzentrum / Kita Helene Bresslau
- Familienzentrum / Kita Haus Barbara
- AWO-Familienzentrum / Kita Drachennest III
- Familienzentrum / Kita Kinderstube - Travemünde
- Familienzentrum / Kita Sprungtuch e.V. BunteKuh
- Familienzentrum / Kita Beim Meilenstein
- Familienzentrum Kinderhaus Alsheide
- Familienzentrum / Kinderclub
- Familienwegweiser
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen Jugendamt
- Familienbildung
- Telefon-Hotlines
- Beratungsstellen für Familien
- Kindertagesbetreuung
- Jugendamt
- Finanzielle Unterstützung
- Elterngeld/Kindergeld
- Freizeit
- Kinder von 3 - 6
- Kinder von 6 - 12
- Kinder von 6 - 12
- Schule
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Beratung und Unterstützung
- Beratung und Unterstützung
- Finanzielle Unterstützung
- Hilfe und Tipps für Kinder und Jugendliche
- Beratungsstellen für Familien
- Schulpsychologische Beratungsstelle
- Schulsozialarbeit
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen des Jugendamtes
- Telefon-Hotlines
- Familienservice
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Jugendamt
- Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Jugendliche
- Jugendliche
- Schule
- Schule und dann?
- Berufsausbildung
- Studium
- Jugendarbeit
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Jugendamt
- Beratung und Unterstützung
- Kinder- und Jugendbeteiligung
- Weitere Angebote
- Kinder- und Jugendschutz
- Sport
- Erwachsene
- Bildungsplanung
- Tourismus
- Tourismus
- Lübeck
- Travemünde
- Travemünde
- 200 Jahre Ostseebad
- Schiffe gucken
- Sehenswertes in Travemünde
- Strandleben
- Stadtplan Travemünde
- Travemünder Woche
- Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr
- Freizeit
- Freizeit
- LübeckCard
- Mobilität
- Lübecker Schwimmbäder
- Natur erleben
- Grünanlagen und Spielplätze
- Grünanlagen und Spielplätze
- Stadteingänge
- Patenschaften
- Private Feiern im öffentlichen Grün
- Grillen in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Baum des Jahres
- Baum des Jahres
- Stiel-Eiche
- Rot-Buche
- Sommer-Linde
- Berg-Ulme
- Speierling
- Gewöhnliche Eibe
- Spitz-Ahorn
- Hainbuche
- Eberesche
- Wild-Birne
- Silber-Weide
- Sandbirke
- Gewöhnliche Esche
- Gewöhnlicher Wacholder
- Schwarz-Erle
- Weiß-Tanne
- Rosskastanie
- Schwarz-Pappel
- Wald-Kiefer
- Walnuss
- Berg-Ahorn
- Vogel-Kirsche
- Elsbeere
- Europäische Lärche
- Wild-Apfel
- Trauben-Eiche
- Feld-Ahorn
- Winter-Linde
- Fichte
- Esskastanie
- Flatterulme
- Robinie
- Stechpalme
- Rot-Buche
- Moor-Birke
- Mehlbeere
- Roteiche
- Karte Baum des Jahres
- Schnullerbaum
- Baumkataster
- Klimabäume
- Baumspende
- Habitatbäume
- Anders parken – Bäume schützen
- Grün- und Parkanlagen
- Stadtnahe Erholung
- Spielen in der Stadt
- Sport
- Wochenmärkte
- Weihnachtsmärkte
- Schwimm- und Badegewässer
- Laternenumzug
- Kultur
- Kultur
- Museen
- Museen
- Museum Holstentor
- Buddenbrookhaus
- Günter Grass-Haus
- Kunsthalle St. Annen
- Museum Behnhaus Drägerhaus
- Willy-Brandt-Haus
- Museum für Natur und Umwelt
- KOLK 17 Figurentheater & Museum
- Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk
- Grenzmuseum
- Europäisches Hansemuseum
- Katharinenkirche
- St. Annen-Museum
- Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck
- Niederegger Marzipansalon
- Museum Alter Leuchtturm Travemünde
- Overbeck-Gesellschaft
- Museum Haus Hansestadt Danzig
- Theater
- Musik- & Kongresshalle
- Schleswig-Holstein Musik Festival
- Nordische Filmtage Lübeck
- Musikhochschule
- Bibliothek der Hansestadt Lübeck
- Stadtarchiv
- Kulturbüro
- Historische Pflaster
- Archäologie und Denkmalpflege
- Stolpersteine
- Galerien
- Filmstadt Lübeck
- Gedenkstätte Lübecker Märtyrer
- Wissenschaftspfad
- Kolosseum Lübeck
- Wohnen in Lübeck
- Veranstaltungen
- Stadtentwicklung
Stadtentwicklung
- Stadtentwicklung
- Lärmschutz
- Radverkehr
- Klima
- Klima
- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel
- Nachhaltigkeit
- Klimafonds
- Smart City Lübeck
- Smart City Lübeck
- Smart City Family
- Projekte und Maßnahmen
- Wir digital für Lübeck
- Digitale Strategie
- Smart City Infrastruktur
- Beteiligung
- überMORGEN
- überMORGEN
- Stadtentwicklungsdialog
- Rahmenplan und Mobilitätskonzept Innenstadt
- Verkehrsentwicklungsplan
- Stadtteilveranstaltungen
- Flächennutzungsplan
- Radverkehrskonzept
- Hafenentwicklungsplan
- Touristisches Entwicklungskonzept
- Kommunales Integrationskonzept
- Umfrage Klimaschutzmaßnahmen für 2021
- Masterplan Klimaschutz
- Übergangsweise
- Wirtschaftsförderung
- Priwall-Promenade
- Stadtplanung
- Stadtplanung
- Einzelhandelskonzepte
- Gewerbeflächen
- Wohnungsmarktberichte
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Verkehrskonzepte / ÖPNV
- Lübeck 2030
- Aktuelle Wohnbauprojekte
- Wohnquartier Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld
- Gründungsviertel
- Bauleitplanung
- Städtebauförderung
- Infrastruktur
- Stadtbildpflege
- Verkehrsmanagementsystem
- Hafen Lübeck
- Sportentwicklung
- Fehmarnbeltquerung
- Presse
Vorlage - VO/2015/02684
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag
- Die in der Anlage aufgeführten Projekte
1. Umbau Buddenbrookhaus. Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum Buddenbrookhaus 2018 – Erweiterung, Umbau, Neukonzeption
2. Umgestaltung westlicher Altstadtrand
An der Untertrave – Abschnitt Holstentor bis Fischergrube
werden von der Hansestadt Lübeck für das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ (2015) angemeldet.
- Der kommunale Pflichtanteil von 10% wird bei Förderzusage im Förderzeitraum bis 2018 in den Haushalt eingestellt.
Verfahren
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis: |
| 1.201 Haushalt und Steuerung 4.041.7 Lübecker Museen 4.491 Archäologie und Denkmalpflege 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Zustimmend; die Belange des Bereichs Haushalt und Steuerung werden im weiteren Verfahren berücksichtigt.
|
|
|
|
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | x | Nein |
Begründung: |
| Ein Antrag auf Fördermittel berührt nicht die Belange von Kindern und Jugendlichen |
|
|
|
Die Maßnahme ist: | x | neu |
| x | freiwillig |
|
| vorgeschrieben durch: |
|
|
|
Finanzielle Auswirkungen: |
| Nein |
| x | Ja (siehe Begründung und Anlage) |
Begründung
1. „Nationale Projekte des Städtebaus“ (2015)
Mit dem erneuten Ausruf des Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ für 2015 stellt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) in den Jahren 2015 bis 2019 in Summe 50 Millionen Euro bereit, um herausragende Projekte des Städtebaus aufzuzeigen und zu unterstützen. Zusätzlich werden voraussichtlich weitere Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes bereitgestellt.
Auch 2015 stellen Denkmalensembles von nationalem Rang wie z.B. UNESCO-Welterbestätten und bauliche Kulturgüter mit außergewöhnlichem Wert einschließlich Maßnahmen in deren Umfeld sowie energetische Erneuerung und Grün in der Stadt die Förderschwerpunkte dar.
Die Bundesmittel sind im aktuellen Haushaltsjahr zu binden und werden – vergleichbar der Städtebauförderung – in fünf Jahresraten 2015 bis 2019 kassenmäßig zur Verfügung gestellt. Die zusätzlichen Mittel werden dagegen in drei Jahresraten 2016 bis 2018 kassenmäßig zur Verfügung gestellt.
Die Bundesregierung beabsichtigt, das Bundesprogramm im Haushaltsjahr 2016 fortzuführen.
Förderfähige Maßnahmen
Nationale Projekte des Städtebaus sind national und international wahrnehmbare, größere städtebauliche Projekte mit deutlichen Impulsen für die jeweilige Gemeinde oder Stadt, die Region und die Stadtentwicklungspolitik in Deutschland insgesamt. Sie zeichnen sich durch einen besonderen Qualitätsanspruch („Premiumqualität“) hinsichtlich des städtebaulichen Ansatzes, der baukulturellen Aspekte und von Beteiligungsprozessen aus und weisen Innovationspotential auf.
Nationale Projekte des Städtebaus sind Projekte, mit denen in der Regel Aufgaben und Probleme von erheblicher finanzieller Dimension gelöst werden. Mit einem überdurchschnittlich hohen Fördervolumen soll eine schnellere und ggf. breitere Intervention und Problembearbeitung möglich sein. Die Projekte können Bestandteil einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme sein.
Antragsteller
Antragsberechtigt sind die Kommunen, in deren Gebiet sich das zu fördernde Projekt befindet. Projekte im Rahmen des Förderprogramms müssen von der betreffenden Kommune mitfinanziert werden.
Komplementärfinanzierung
Der Eigenanteil der Kommune beträgt grundsätzlich ein Drittel der förderfähigen Projektkosten. Bei Vorliegen eine Haushaltsnotlage kann sich der kommunale Eigenanteil auf bis zu 10% reduzieren. Die Haushaltsnotlage ist durch das Land zu bestätigen. Das Innenministerium Schleswig-Holstein hat diese Bestätigung in Aussicht gestellt. Länder und Kommunen müssen ihre finanziellen Eigenanteile sofort, spätestens ab 2016, erbringen.
Auswahl der Projekte
Das BMUB wird sich bei der Auswahl der zu fördernden Projekte von einem unabhängigen Expertengremium beraten lassen, das sich u.a. aus Vertretern des deutschen Bundestages sowie Fachleuten verschiedener Disziplinen (z.B. Stadt- und Landschaftsplanung, Städtebau, Denkmalpflege) zusammensetzt.
Für die Auswahl der Projekte sind u.a. folgende Kriterien ausschlaggebend:
- nationale bzw. internationale Wahrnehmbarkeit und Wirkung,
- überdurchschnittliche Qualität hinsichtlich Bürgerbeteiligung, Städtebau und Baukultur
- erhebliches und überdurchschnittliches Investitionsvolumen
- Machbarkeit und zügige Umsetzbarkeit
- Innovationspotential
Terminplanung
20. Mai 2015: Fristende zur Einreichung der Projektanträge beim Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR)
21. Mai 2015 Fristende Einreichung der Anträge beim für die
(Datum Poststempel) Städtebauförderung zuständigen Landesressort.
1. Juni 2015 Fristende für die Einreichung der unterschriebenen Anträge, des Ratsbeschlusses sowie ggf. Nachweis über eine finanzielle Beteiligung Dritter beim BBSR.
9. Juni 2015 Fristende für die Einreichung der Stellungnahmen der Länder beim BBSR.
Mai/Juni 2015 Sichtung und Vorbewertung der Förderanträge durch das BBSR bzw. beauftragte Dritte.
29. Juni 2015 Tagung des unabhängigen Expertengremiums mit dem Ziel, eine Förderempfehlung für den Bund sowie einen Gesamtvorschlag für den Abfluss und die Bindung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu erarbeiten.
Juli–September 2015 Qualifizierung der Zuwendungsanträge / ggf. Baufachliche Prüfung nach RZBau / Anträge auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn durch die Kommunen / Eingang der Zuwendungsanträge.
Oktober 2015 Erlass entsprechender Förderbescheide durch das BBSR.
Umbau Buddenbrookhaus. Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum
„Buddenbrookhaus 2018 – Erweiterung, Umbau, Neukonzeption“
Für Lübeck stellt das Buddenbrookhaus einen großen Wirtschaftsfaktor dar. Als fester Bestandteil des nationalen Gedächtnisses firmiert das Buddenbrookhaus neben dem Holstentor als wichtigste touristische Attraktion der Hansestadt Lübeck. Kulturinteressierte aus der ganzen Welt besuchen die einzige Erinnerungsstätte an die Familie Mann in Deutschland. Mehr als 70% der BesucherInnen kommen nicht aus Lübeck, das heißt, dass sie in großer Zahl in Lübeck übernachten, verzehren, weitere Kulturstätten besuchen und den Einzelhandel stärken.
Um auch zukünftig als touristischer Anlaufpunkt bestehen und Kulturtouristen nach Lübeck locken zu können, muss das Buddenbrookhaus baulich erweitert und seine Dauerausstellung neu konzipiert werden. Anderenfalls wird das Literaturmuseum und damit eines von Lübecks Alleinstellungsmerkmalen nicht länger konkurrenzfähig sein und literaturinteressierte Kulturtouristen an andere Bundesländer verlieren.
Diese Gefahr hat der Bund unlängst erkannt und entsprechend den Ankauf des Nachbargrundstücks Mengstraße 6 und damit die Erweiterung des Museums mit einer Fördersumme von 300 TEURO ermöglicht.
Diese Investition ist aus folgenden konkreten Gründen unverzichtbar:
Platzmangel
Mit der Ausweitung von Archiv und Bibliothek hat das Museum die Grenzen seiner Kapazitäten erreicht. Schon jetzt sind große Teile der Sammlung und des Museumsbedarfs in externe Räume ausgelagert, was Kosten aufwirft und den Museumsablauf behindert. Auch der steigenden Anzahl der BesucherInnen – insbesondere im Rahmen von Führungen – kann das jetzige Buddenbrookhaus nicht mehr gerecht werden. Führungen, die parallel angemeldet sind, müssen aus Platzmangel abgewiesen werden. Weder für die einnahmestarken Veranstaltungen noch für ein museumspädagogisches Programm steht genügend Raum zur Verfügung: Vernissagen finden mehrheitlich außerhalb des Museums statt; ein museumspädagogischer Ort für Workshops u.ä. existiert nicht, fasst der für Fortbildungen und Workshops genutzte Gewölbekeller doch max. 24 Personen – die Schulklassen sind in der Regel bis zu 30 Personen stark. Auch Tagungen und Symposien des Forschungszentrums, das weltweit zu den wichtigsten Institutionen der Mann-Forschung gehört und vier literarische Gesellschaften beherbergt, können derzeit nicht im eigenen Haus realisiert werden. Selbst Büroarbeitsplätze müssen ausgelagert werden. Darüber hinaus sind die Möglichkeiten des Museumsshops, eine angemessene Angebotsvielfalt auf attraktive und damit einträgliche Weise präsentieren zu können, derzeit überaus begrenzt.
Funktionale Mängel
Als architektonischer Nachteil erwiesen haben sich die zwei Treppenhäuser, die einen Zugang zur Dauerausstellung von zwei Seiten ermöglichen. Derart vermeiden es BesucherInnen in beträchtlicher Zahl, Eintritt zu bezahlen, da ihr Zugang zur Ausstellung von den MitarbeiterInnen an der Museumskasse nicht eingesehen werden kann. Da die Ausstellungsräume vom vorderen Treppenhaus ebenso wie vom hinteren aufgesucht werden können, fehlt ein Rundlauf, dem die Ausstellungsdramaturgie folgt. Dies hat die Orientierungslosigkeit und damit den Missmut der BesucherInnen zur Folge.
Die engen Auf- und Abgänge zerreißen die Dauerausstellung inhaltlich und genügen den Anforderungen an ein barrierefreies Museum nicht. Für das Rangieren mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwagen vor dem Fahrstuhl reicht der Platz nicht aus. Es besteht die Gefahr, beim Rangiervorgang rückwärts die Treppe hinabzustürzen.
Ferner ist der Energieverbrauch des Museums weit überdurchschnittlich – es müssen gerade in den Bereichen Klimatisierung und Beleuchtung nachhaltigere Lösungen gefunden werden, um die Energiekosten zu beschränken und damit die Kosten für den Bauunterhalt zu reduzieren.
Veraltete Ausstellungsgestaltung
Die einst vielfach preisgekrönte Ausstellung wird von den BesucherInnen zunehmend kritisch wahrgenommen, weil den museologischen Standards gerade im Hinblick auf den Medieneinsatz im Museum nicht Genüge getan wird. Zugleich aber hat der Wert der Dinge im Zeitalter des Digitalen gewonnen. Das Museum wird vermehrt als letzte Bastion des Haptischen und Authentischen aufgesucht – die jetzige Dauerausstellung im Buddenbrookhaus behandelt die Realien hingegen eher stiefmütterlich wie in den 1990er Jahren üblich, um jeden Verdacht des Reliquienkultes zu negieren.
Die technische Revolution und der Siegeszug des Bildes haben gravierende Folgen für jedes Literaturmuseum, in dem der Text dominiert: Die Ausstellung im Buddenbrookhaus hat mit den veränderten Wahrnehmungsweisen der BesucherInnen nicht Schritt gehalten und wird konsequent als anstrengend, weil zu textlastig empfunden. Auch der Anspruch der BesucherInnen, im Museum eine aktive und partizipative Rolle einzunehmen, findet sich im Buddenbrookhaus kaum berücksichtigt.
Darüber hinaus hat materieller Verschleiß in der Dauerausstellung Einzug gehalten, beispielsweise ist das Holz der Vitrinen ist so verzogen, dass Einsturzgefahr besteht. Ferner gib die in Kabeltrassen offen präsentierte Technik unter unverputzten niedrigen Decken ebenso wie das limonengrüne Ausstellungskonzept Zeugnis überlebten Raumdesigns ab, das den ästhetischen Ansprüchen der Gegenwart nicht entspricht.
Die neue Dauerausstellung soll stärker als bisher den Erwartungen der BesucherInnen begegnen, das heißt, den Bildern im Kopf von einem alten Kaumannshaus mit repräsentativer Deckenhöhe und großzügiger Freitreppe in einer nicht minder beeindruckenden Diele gerecht werden. Der derzeitige Zweckbau eignet sich dafür nicht, da eine im Jahr 2000 eingezogene Zwischendecke zwar die Ausstellungsfläche auf ein Mindestmaß vergrößert, aber jedes Gefühl für die historische Raumweite ausbremst. Entsprechend groß ist die Enttäuschung der BesucherInnen: Hinter der berühmten weißen Barockfassade wird die Vorstellung vom Wohnhaus der Familie Buddenbrook, die zahlreiche Verfilmungen der Buddenbrooks geprägt haben, nicht bedient.
Veralteter Forschungsstand
Der Informationsgehalt der bestehenden Dauerausstellung hinkt der Forschung und der Rezeption – etwa Breloers TV-Dreiteiler „Die Manns“ und dem Kinofilm Buddenbrooks von 2008 – um 15 Jahre hinterher. Entsprechend kommt das Haus seinem Bildungsauftrag nur noch eingeschränkt nach. Auch verengt die jetzige Ausstellung den Blick auf die Familie Mann, da sie sich zu sehr auf Lübeck als Geburts- und Romanort beschränkt. Das Besondere de Familie Mann besteht jedoch gerade in ihrer Welthaltigkeit und Internationalität, die ohne die Lübecker Prägung gleichwohl nicht möglich gewesen wäre. Die neue Ausstellung muss erzählen, wie der Weg von Lübeck in die globale Wirksamkeit führte und welche gesellschaftlichen und politischen Prozesse dazu beitrugen. Die Familie Mann verdankt ihre globale Berühmtheit nicht der Literatur allein: In ihr verdichtet sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Literatur, Politik und Privates gehen in ihr eine Verbindung ein, die uns die deutsche Geschichte im globalen Kontext sehen lässt. Dieses Narrativ muss auch die Architektur ‚erzählen’, die Ausstellung darf nicht unabhängig vom Bau bestehen. Dies umzusetzen, kann gelingen, indem die Ausstellung im Geburtsort Lübeck, d.h. im Buddenbrookhaus, beginnt und sich in der Mengstraße 6 um die Weltbürgerlichkeit der Familie Mann und ihre internationale Bedeutung ausdehnt: Derart würden ‚gebauter Roman’ und ‚gebaute Welthaltigkeit’ eine sinnstiftende Beziehung eingehen.
Die angeführten Punkte machen deutlich, dass das Buddenbrookhaus umfassend erneuert werden muss, sprich baulich, inhaltlich und gestalterisch. Entsprechend hoch sind die mit dem Prestigebau verbundenen Gesamtkosten, die sich auch bei einem Umbau im Bestand nicht reduzieren, wie Machbarkeitsstudie und zweite Kostenprüfung ergeben haben. Insofern ist die Antragstellung beim nationalen Städtebauprogramm des Bundes von immanenter Wichtigkeit.
Kosten / finanzielle Auswirkung
Die geplante Antragstellung beim Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ versteht sich als erster Baustein, die Finanzierung für den Umbau des Buddenbrookhauses sicherzustellen. Da der Umbau des Buddenbrookhauses ohne Bundesmittel nicht realisiert werden kann, ist eine explizite Antragstellung unverzichtbar. Beantragt wird ein Förderbetrag in Höhe von 16 Mio. Euro. Nur in dem Fall, dass der Umbau des Buddenbrookhauses durch das besagte Bundesprogramm gefördert wird, beträgt der kommunale Pflichtanteil 10% der Fördersumme.
Erwartungsgemäß wird die Fördersumme des Bundes nicht der beantragten Summe von 16 Millionen Euro entsprechen. Nach geltendem Haushaltsrecht reduziert sich in diesem Fall auch der kommunale Eigenanteil, der sich auf die tatsächlich bewilligte, nicht auf die beantragte Summe bezieht.
Nach Rücksprache mit dem zuständigen Fachministerium des Bundes kann das Land Schleswig-Holstein für seine beantragten Projekte insgesamt maximal mit einer Fördersumme von 5 Millionen Euro rechnen.
Grundlage der Kostenkalkulation ist die Machbarkeitsstudie des Architekturbüros Heyroth & Kürbitz durchgeführt und betreut durch das Planungsbüro Daniel Luchterhandt im Jahr 2014, extern kostengeprüft durch DU Diederichs Projektmanagement.
Die Machbarkeitstudie hat als Massenstudie drei verschiedene Varianten geprüft, die den Anforderungen des Städtebaus, der Denkmalpflege und des standortlosen Raumprogramms in unterschiedlicher Weise gerecht werden. Dennoch: Mit der Zustimmung zur Vorlage trifft die Bürgerschaft ausdrücklich keine Entscheidung über einen hochbaulichen Entwurf oder ein Gestaltungskonzept. Da außerdem die Kosten für alle drei Varianten, welche die Machbarkeitsstudie ausgelotet hat, gleich hoch sind, fällt die Bürgerschaft auch keine Entscheidung zugunsten oder zulasten einer bestimmten Variante.
Die finanzielle Machbarkeit des Projekts soll durch eine Mischfinanzierung gesichert werden. Geplant ist eine Komplementärfinanzierung, die sich im Bezug auf die Gesamtkosten wie folgt zusammensetzt:
Bund/Hansestadt Lübeck: 30%
Land: 30%
Stiftungen, Spenden: 25%
Sponsoring: 15%
2014 hat die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck in kontinuierlichem Austausch mit dem Hochbau, der Denkmalpflege, der Stadtplanung und der städtischen Welterbebeauftragten die Machbarkeit des Projekts „Buddenbrookhaus 2018“ in einer Machbarkeitsstudie prüfen lassen. Sie kommt zu dem Schluss, dass alle Erfordernisse, die vom Denkmalschutz, der Museumsleitung, der Stadtplanung und dem Hochbauamt vorgetragen wurden, am Standort gemeinsam berücksichtigt und bei einem Planungsbeginn 2016 sowie einer zweijährigen Bauzeit bis 2018 realisiert bzw. zügig umgesetzt werden können. Die abgestimmten Grundlagen machen eine sofortige Weiterbearbeitung bzw. Wettbewerbsausschreibung mit zeitnahem Baubeginn möglich.
Mit der Akquise von Fördermitteln für den Umbau und die Neukonzeption der Ausstellung ist bereits begonnen worden. Land und Bund haben ihre Förderung zugesagt und unterstützen die Vorarbeiten an dem Projekt bereits seit 2013. Konkret in Aussicht gestellt wurden EFRE-Mittel (europäischer Fond für regionale Entwicklung) zur Realisierung des Projekts, IKE-Mittel (Investitionsprogramm Kulturelles Erbe) wurden vom Land bereits für das Buddenbrookhaus reserviert.
Auch ausgewählte Stiftungen wie die Lübecker Jürgen-Wessel-Stiftung, die Commerzbank-Stiftung und die Volkswagen-Stiftung fördern ‚Buddenbrookhaus’ 2018 bereits jetzt. Der Kreis der Förderer wird sich, so signalisieren die Vorgespräche mit anderen Stiftungen, erhöhen, wenn ein Architekturwettbewerb einen konkreten Entwurf hervorgebracht hat. Avisiert ist hierfür das erste Quartal 2016. Parallel betreibt die Sponsoringagentur Causales Sponsorenakquisition in der freien Wirtschaft für das Projekt, zugleich sind vom Buddenbrookhaus private Spenden eingeworben worden.
Umgestaltung Westlicher Altstadtrand
„Vom Holstentor zum Europäischen Hansemuseum“
Abschnitt Holstenstraße - Fischergrube mit Uferpromenade
Der westliche Altstadtrand ist vom Holstentor kommend erstes Aushängeschild für Besucher der Hansestadt Lübeck und ein städtebauliches Herzstück innerhalb der Pufferzonen des UNESCO-Welterbes „Lübecker Altstadt“. Während das Teilstück an der Obertrave bereits 2007 umgestaltet worden ist, präsentiert sich die Untertrave weiterhin als überdimensionierte Verkehrsfläche mit ungestalteten, maroden und verwahrlosten Freiflächen. Mit Eröffnung der Eric-Warburg Brücke und der Nordtangente 2008 konnte zwar eine entscheidende verkehrliche Entlastung dieser bis dahin für den Durchgangsverkehr genutzten Straße erreicht werden - aufgrund der finanziellen Situation der Hansestadt Lübeck ist bislang an eine Umgestaltung nicht zu denken gewesen.
Die westliche Altstadtuferstraße entlang des Travelaufs ist mit 2,4 km die längste Altstadtstraße Lübecks und bereits ab 1300 geschlossen bebaut.
Der westliche Altstadtuferrand, der ehemals von regen Warenverkehr und Leben durch den Hafen und seine Nutzung geprägt war, hat durch den Strukturwandel der Hafenwirtschaft große Veränderungen erfahren. Auch heute noch prägen Lager- und Kaufmannshäuser aus vielen Jahrhunderten den westlichen Altstadtrand an der Untertrave. Wo früher Schleppkähne und Seeschiffe ankerten, starten heute Bootsfahrten rund um die Lübecker Altstadt. Vis-à-vis der mittleren Wallhalbinsel haben Traditionsschiffe ihren Liegeplatz gefunden und gegenüber der nördlichen Wallhalbinsel wurde ein Sportboothafen angelegt, der die Möglichkeit bietet, die Lübecker Altstadt direkt mit Booten anzufahren. Trotz dieser maritimen Angebote ist das stadtseitige ehemalige Hafenareal selbst seit Jahrzehnten durch ungestaltete Parkplätze und mehrspurige Straßen geprägt, die das Einbeziehen des „Wassers“ in die Stadtstruktur unmöglich machten.
Die Uferzonen und Straßen des westlichen Altstadtrandes haben für das Erscheinungsbild der Altstadt, für ihre Anziehungskraft und ihre Ausstrahlung große städtebauliche Bedeutung. Die Umgestaltung der Straßenräume bietet die Chance, die Einheit von Altstadt und Wasserflächen durch gut gestaltete und nutzbare Flächen wiederherzustellen und sowohl ein lebendiges Vorfeld für die Randbebauung als auch eine Visitenkarte und attraktives Entree für das UNESCO-Welterbe „Lübecker Altstadt“ an dieser städtebaulich bedeutsamen Kante zu schaffen.
Wesentliches Ziel der Umgestaltung des westlichen Altstadtrandes ist damit die Attraktivierung des öffentlichen Raumes entsprechend ihrer Bedeutung als Stadteingang in das UNESCO-Welterbe Lübecker Altstadt. Die beliebten Flächen am Wasser der Trave mit dem vorhandenen maritimen Leben durch Bootsrundfahrten und Museumshafen sollen zukünftig als aufgewertete öffentliche Räume zum Flanieren und Verweilen einladen. Der heute überdimensionierte Straßenraum kann den heutigen Erfordernissen angepasst werden. Damit können die Hausvorfelder in einer attraktiven Breite ausgebaut werden, die Außengastronomie an dieser maritimen Stadtseite ermöglicht. Ziel ist es damit auch, Impulse für die ortsansässige Wirtschaft zu geben und ähnlich wie an der Obertrave, zur Restaurierung der Gebäude anzuregen und die im Ansatz vorhandenen Angebote für Touristen und Bewohner zu vervollständigen.
Anders als im Projektantrag 2014 (siehe VO/2014/01912) wird für die Flächen im Sanierungsgebiet (Fischergrube – Drehbrückenplatz – Anschluss Hansemuseum) zurzeit ein Antrag auf Städtebauförderung vorbereitet, so dass nunmehr die Flächen vom Holstentor bis zur Fischergrube mit den gesamten Kaiflächen Bestandteil des Antrages sind.
Grundlage der Planung ist weiterhin das Ergebnis des mit breiter Bürgerbeteiligung ausgelobten Städtebaulichen Wettbewerbs aus 2003 mit dem Siegerentwurf der Arbeitsgemeinschaft aus den Landschaftsarchitekten TGP, den Architekten PPP und Atelier10, Lübeck.
Maßnahmen:
- Ausbau der Hafenkante (Breite 12,50m)
Wasserseitige Promenade mit Flanier- und Aufenthaltsmöglichkeiten,
Materialkanon der Obertrave, Sitz- und Liegepodesten aus Holz, Flächen zum Bespielen mit öffentlichen Leben
- Rückbau der Straße (auf ca. 9,20m Breite)
Mittige Fahrbahn, einspurig im Zweirichtungsverkehr und Schutzstreifen für Radfahrer
- Verbreiterung der Hausvorfelder (auf ca. 10m Breite)
Platz für Außengastronomie, großzügiger Fußweg
Kosten / finanzielle Auswirkungen
Gesamtkosten
Untertrave Förderantrag 9,20 Mio.€
KAG-Beiträge -1,82 Mio.€ (anteilig Fahrbahn, Gehweg, Bewohner- Parken, Beleuchtung)
![]()
Kosten 7,38 Mio.€
90% Förderung 6,64 Mio.€
Anteil Stadt 0,74 Mio.€
Abschnitte
Abschnitt Braunstraße bis Mengstraße (wasserseitige Promenade ab Holstentorplatz)
Baulänge 225m + 50 m Promenade ab Holstentorplatz
Anteil Gesamtkosten 46% ca. 4,20 Mio.€
KAG Beiträge ca. 0,79 Mio.€
90% Förderung ca. 3,07 Mio.€
Anteil Stadt ca. 0,34 Mio.€
Abschnitt Mengstraße bis Fischergrube (wasserseitige Promenade bis Drehbrückenplatz)
Baulänge 300m + 120 m Promenade bis Drehbrückenplatz
Anteil Gesamtkosten 54% ca. 5,00 Mio.€
KAG Beiträge ca. 1,03 Mio.€
90% Förderung ca. 3,57 Mio.€
Anteil Stadt ca. 0,40 Mio.€
Es ist zu erwarten, dass die Fördersumme des Bundes nicht der beantragten Summe von 9,2 Mio. € entsprechen wird. Nach geltendem Haushaltsrecht reduziert sich in diesem Fall auch der kommunale Eigenanteil, der sich auf die tatsächlich bewilligte, nicht auf die beantragte Summe bezieht.
Zeitplan
Ende 2015 - Mitte 2016: Entwurfsbearbeitung mit Vorbereitung der Ausschreibung
Mitte 2016 - Ende 2019: Durchführung in Abschnitten
Anlagen
- Stellungnahme Haushalt und Steuerung
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
| 1 | öffentlich | Stellungnahme_HS_NatProj (15 KB) | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||