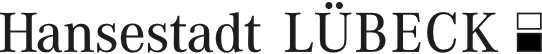- Bürgerservice
- Rathaus
Rathaus
- Rathaus
- Karriereportal
- Politik
- Verwaltung
- Verwaltung
- Antidiskriminierung bei der Hansestadt Lübeck
- Bürgermeisterkanzlei
- Büro der Bürgerschaft
- Feuerwehr
- Finanzen
- Frauenbüro
- Friedhöfe
- Gebäudemanagement
- Gesundheitsamt
- Gesundheitsamt
- Infektionsschutz und Hygiene
- Infektionsschutz und Hygiene
- Übertragbare Krankheiten
- Fragen und Antworten (FAQ)
- Hygieneüberwachung
- Tuberkuloseberatung
- Impfungen
- Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- Zahnärztlicher Dienst
- Amtsärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit
- Weitere Aufgaben
- Ihre Meinung zählt
- Tag der seelischen Gesundheit
- Konzernstruktur
- Kurbetrieb Travemünde
- Lübeck Port Authority
- Ordnungsamt
- Recht
- Soziale Sicherung
- Stabsstelle Migration und Ehrenamt
- Stadtgrün und Verkehr
- Stadtplanung und Bauordnung
- Stadtteilkonferenzen
- Stadtwald
- Standesamt
- Statistik
- Stiftungsverwaltung
- Straßenverkehrsbehörde
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
- Naturschutz
- Naturschutz
- Schutzgebiete
- Schutzgebiete
- Naturdenkmale flächenhaft
- Naturdenkmale objektbezogen
- Naturdenkmale objektbezogen
- Hängebuche in der Gärtnergasse
- Silberlinde am Koberg
- Ginkgo am Lindenplatz
- Bäume auf dem Jerusalemsberg
- Platanen auf dem Burgtorfriedhof
- Eichen am Waldsaum
- Lindenallee zum Gut Strecknitz
- Eichen- und Lindenallee in Padelügge
- Eichen vor der Schule in Niendorf
- Eichen auf dem Jahnplatz
- Natura 2000-Gebiete
- Geschützte Landschaftsbestandteile
- Naturschutzgebiete
- Landschaftsschutzgebiete
- Arten- und Biotopschutz
- Landschaftsplanung
- Erholung und Natur
- Projekte
- Klima
- Wasser
- Abfall
- Boden
- Lebensmittelüberwachung
- Veterinärwesen
- Gesundheitlicher Umweltschutz
- Hilfe in Notlagen
- Wirtschaft und Liegenschaften
- Wohnraum für Studierende
- Lübeck international
- Stadtleben
Stadtleben
- Stadtleben
- Familie und Bildung
- Familie und Bildung
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Schwangerschaft & Kinder unter 3
- Stillfreundliche Stadt
- Beratung und Bildung
- Beratung und Bildung
- Beratung in der Schwangerschaft
- Willkommensbesuche
- Beratungsstellen Frühe Hilfen
- Familienzentren
- Familienzentren
- Familienzentrum / Kita Brüder-Grimm-Ring
- Familienzentrum / Kita Familienkiste
- Familienzentrum / Kita Schaluppenweg
- Familienzentrum / Kita Willy Brandt
- Familienzentrum / Kita St. Bonifatius
- AWO-Familienzentrum / Kita Redderkoppel
- Familienzentrum / Kinderhaus Pellwormstraße
- Familienzentrum / Kita Behaimring
- Familienzentrum / Kita Dreifaltigkeit
- Familienzentrum / Kita Helene Bresslau
- Familienzentrum / Kita Haus Barbara
- AWO-Familienzentrum / Kita Drachennest III
- Familienzentrum / Kita Kinderstube - Travemünde
- Familienzentrum / Kita Sprungtuch e.V. BunteKuh
- Familienzentrum / Kita Beim Meilenstein
- Familienzentrum Kinderhaus Alsheide
- Familienzentrum / Kinderclub
- Familienwegweiser
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen Jugendamt
- Familienbildung
- Telefon-Hotlines
- Beratungsstellen für Familien
- Kindertagesbetreuung
- Jugendamt
- Finanzielle Unterstützung
- Elterngeld/Kindergeld
- Freizeit
- Kinder von 3 - 6
- Kinder von 6 - 12
- Kinder von 6 - 12
- Schule
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Beratung und Unterstützung
- Beratung und Unterstützung
- Finanzielle Unterstützung
- Hilfe und Tipps für Kinder und Jugendliche
- Beratungsstellen für Familien
- Schulpsychologische Beratungsstelle
- Schulsozialarbeit
- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung
- Beratungsstellen des Jugendamtes
- Telefon-Hotlines
- Familienservice
- Elternbriefe
- Alleinerziehend
- Jugendamt
- Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Jugendliche
- Jugendliche
- Schule
- Schule und dann?
- Berufsausbildung
- Studium
- Jugendarbeit
- Freizeit und außerschulische Bildung
- Bildung, Kultur, Wissenschaft
- Jugendamt
- Beratung und Unterstützung
- Kinder- und Jugendbeteiligung
- Weitere Angebote
- Kinder- und Jugendschutz
- Sport
- Erwachsene
- Bildungsplanung
- Tourismus
- Tourismus
- Lübeck
- Travemünde
- Travemünde
- 200 Jahre Ostseebad
- Schiffe gucken
- Sehenswertes in Travemünde
- Strandleben
- Stadtplan Travemünde
- Travemünder Woche
- Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr
- Freizeit
- Freizeit
- LübeckCard
- Mobilität
- Lübecker Schwimmbäder
- Natur erleben
- Grünanlagen und Spielplätze
- Grünanlagen und Spielplätze
- Stadteingänge
- Patenschaften
- Private Feiern im öffentlichen Grün
- Grillen in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Bäume in der Stadt
- Baum des Jahres
- Baum des Jahres
- Stiel-Eiche
- Rot-Buche
- Sommer-Linde
- Berg-Ulme
- Speierling
- Gewöhnliche Eibe
- Spitz-Ahorn
- Hainbuche
- Eberesche
- Wild-Birne
- Silber-Weide
- Sandbirke
- Gewöhnliche Esche
- Gewöhnlicher Wacholder
- Schwarz-Erle
- Weiß-Tanne
- Rosskastanie
- Schwarz-Pappel
- Wald-Kiefer
- Walnuss
- Berg-Ahorn
- Vogel-Kirsche
- Elsbeere
- Europäische Lärche
- Wild-Apfel
- Trauben-Eiche
- Feld-Ahorn
- Winter-Linde
- Fichte
- Esskastanie
- Flatterulme
- Robinie
- Stechpalme
- Rot-Buche
- Moor-Birke
- Mehlbeere
- Roteiche
- Karte Baum des Jahres
- Schnullerbaum
- Baumkataster
- Klimabäume
- Baumspende
- Habitatbäume
- Anders parken – Bäume schützen
- Grün- und Parkanlagen
- Stadtnahe Erholung
- Spielen in der Stadt
- Sport
- Wochenmärkte
- Weihnachtsmärkte
- Schwimm- und Badegewässer
- Laternenumzug
- Kultur
- Kultur
- Museen
- Museen
- Museum Holstentor
- Buddenbrookhaus
- Günter Grass-Haus
- Kunsthalle St. Annen
- Museum Behnhaus Drägerhaus
- Willy-Brandt-Haus
- Museum für Natur und Umwelt
- KOLK 17 Figurentheater & Museum
- Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk
- Grenzmuseum
- Europäisches Hansemuseum
- Katharinenkirche
- St. Annen-Museum
- Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck
- Niederegger Marzipansalon
- Museum Alter Leuchtturm Travemünde
- Overbeck-Gesellschaft
- Museum Haus Hansestadt Danzig
- Theater
- Musik- & Kongresshalle
- Schleswig-Holstein Musik Festival
- Nordische Filmtage Lübeck
- Musikhochschule
- Bibliothek der Hansestadt Lübeck
- Stadtarchiv
- Kulturbüro
- Historische Pflaster
- Archäologie und Denkmalpflege
- Stolpersteine
- Galerien
- Filmstadt Lübeck
- Gedenkstätte Lübecker Märtyrer
- Wissenschaftspfad
- Kolosseum Lübeck
- Wohnen in Lübeck
- Veranstaltungen
- Stadtentwicklung
Stadtentwicklung
- Stadtentwicklung
- Lärmschutz
- Radverkehr
- Klima
- Klima
- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel
- Nachhaltigkeit
- Klimafonds
- Smart City Lübeck
- Smart City Lübeck
- Smart City Family
- Projekte und Maßnahmen
- Wir digital für Lübeck
- Digitale Strategie
- Smart City Infrastruktur
- Beteiligung
- überMORGEN
- überMORGEN
- Stadtentwicklungsdialog
- Rahmenplan und Mobilitätskonzept Innenstadt
- Verkehrsentwicklungsplan
- Stadtteilveranstaltungen
- Flächennutzungsplan
- Radverkehrskonzept
- Hafenentwicklungsplan
- Touristisches Entwicklungskonzept
- Kommunales Integrationskonzept
- Umfrage Klimaschutzmaßnahmen für 2021
- Masterplan Klimaschutz
- Übergangsweise
- Wirtschaftsförderung
- Priwall-Promenade
- Stadtplanung
- Stadtplanung
- Einzelhandelskonzepte
- Gewerbeflächen
- Wohnungsmarktberichte
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Verkehrskonzepte / ÖPNV
- Lübeck 2030
- Aktuelle Wohnbauprojekte
- Wohnquartier Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld
- Gründungsviertel
- Bauleitplanung
- Städtebauförderung
- Infrastruktur
- Stadtbildpflege
- Verkehrsmanagementsystem
- Hafen Lübeck
- Sportentwicklung
- Fehmarnbeltquerung
- Presse
Vorlage - VO/2016/03720
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag
Die Ergebnisse eines weiteren Gutachtens zur Aufstellung eines neuen Hafenentwicklungsplans (HEP) bis 2030 liegen vor und werden in diesem Bericht zusammengefasst. Es handelt sich hierbei um das Gutachten „Wachstums- und Entwicklungspotenziale bestehender und neuer Geschäftsfelder“ (Gutachten 6).
Begründung
1 Allgemeines
Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hat am 28.11.2013 unter TOP 10.6 (VO/2013/00904) den Bürgermeister beauftragt, für den Prognosezeitraum bis 2030 einen neuen Hafenentwicklungsplan (HEP) aufzustellen. Die LPA hat hierzu eine Grundstruktur für die Bearbeitung des Hafenentwicklungsplans 2030 aufgestellt. Demnach werden gem. den nachfolgenden Schaubildern im Block 2 die Grundlagendaten vor der eigentlichen Bearbeitung des Hafenentwicklungsplans im Block 4 erhoben. Die Ergebnisse des Gutachtens 6 liegen mittlerweile vor und werden in diesem Bericht zusammengefasst.

Abb. 1 – Grundstruktur HEP2030

Abb. 2 – Grundstruktur Block 2 HEP2030
Die Ergebnisse der Gutachten 1 und 2 wurden bereits mit Bericht vom 01.06.2015 (VO/2015/02673) der Bürgerschaft vorgestellt. Die Ergebnisse des Gutachtens 7 (VO/2016/03552) und des Gutachtens 4 (VO/2016/03550) wurden vor kurzem vorgelegt. Die Ergebnisse des Gutachtens 5 werden mit dem Bericht VO/2016/03721 und des Gutachtens 3 mit dem Bericht VO/2016/03722 vorgestellt.
2 Ergebnisse des Gutachtens 6 „Wachstums- und Entwicklungspotenziale bestehender und neuer Geschäftsfelder“
2.1 Anlass
Obwohl weltweit ein leicht positiver Trend für den RoRo-/Fährverkehr zu erkennen ist, ist die Situation in der Branche im Ostseeraum seit mehreren Jahren stark angespannt. In den nächsten fünf Jahren wird für Nordeuropa aufgrund der Umsetzung der SECA-Regularien (Sulphur Emission Control Area) und der schwachen gesamtwirtschaftlichen Lage in der Eurozone kein bzw. nur ein sehr langsames Wachstum erwartet. Die Situation in der Ostsee wird teilweise sogar als prekär bezeichnet, beispielsweise auch vor dem Hintergrund, dass Finnland bereits die letzten drei Jahre in Folge ein negatives Wirtschaftswachstum verzeichnen musste. Auch die Russlandkrise wirkt sich zusätzlich negativ auf die Umschlagmengen von Finnland und das Baltikum (Transitverkehr mit Russland) aus.
Um Ansatzpunkte für mögliche Umschlagtransporte generieren zu können, muss klar herausgearbeitet werden, wie der Transport organisiert ist, wie er zwischen den verschiedensten Märkten funktioniert und welche Trends in den einzelnen Märkten vorhersehbar sind bzw. erwartet werden können.
Die wichtigsten geographischen Märkte des Lübecker Hafens liegen in Norddeutschland, Westdeutschland und der Alpenregion. Allein auf diese drei Märkte entfallen nahezu zwei Drittel der gesamten Hinterlandverkehre. Auffällig ist, dass sich die bedeutenden Märkte in einem vorrangig west-süd-westlich erstreckenden Korridor befinden. Innerhalb dieses Korridors nimmt die Bedeutung mit zunehmender Distanz ab. Auf die norddeutschen Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein entfallen 35,7%, wovon allein annähernd die Hälfte innerhalb Schleswig-Holsteins verbleibt. Weitere 18,3% der Lübecker Hinterlandverkehre beginnen oder enden in den westdeutschen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Auf die Beneluxstaaten und Frankreich entfallen weitere 8,3%.
Ein zweiter Korridor bedeutender Märkte kann in süd-süd-östlicher Richtung festgestellt werden. Innerhalb dieses Korridors besteht ein anderes Verhältnis zwischen den Anteilen der einzelnen Regionen und der Distanz. So bestehen zwischen dem Seehafen Lübeck und den nahe gelegenen ostdeutschen Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt mit 8,3% beinahe gleich viele Verkehre wie zwischen dem Seehafen Lübeck und den beiden süddeutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern mit 7,1%. Auffällig ist zudem, dass auf die Alpenregionen Norditalien, Österreich, Liechtenstein und Schweiz 11,6% der Lübecker Hinterlandverkehre entfallen.
Seeseitig werden über Lübeck hauptsächlich Dienste von/nach Schweden, Finnland, den baltischen Staaten und Russland abgewickelt. Bezogen auf das jährlich umgeschlagene Bruttogewicht decken diese Destinationen über 98% der Verkehre ab. In den baltischen und finnischen Verkehren sind Transitverkehre nach Russland und in den schwedischen Verkehren sind Transitverkehre nach Norwegen enthalten.
Bestehende und neue Landverbindungen zu den Konkurrenzhäfen (Kiel, Rostock) erhöhen den Wettbewerb des Lübecker Hafens. Grundsätzlich sind die Hafendienstleistungen austauschbar. Zudem ist das prognostizierte Wachstum in der Seeverkehrsprognose nicht so wie in früheren Prognosen. Auch das bedeutet deutlich mehr Wettbewerb unter den Seehäfen.
Im Schweden- und größtenteils im Finnlandverkehr dominiert der Trailer bzw. der RoRo-Umschlag. In den Russland- und den Baltikumverkehren hat der Container als LoLo-Umschlag einen viel höheren Stellenwert.
Grundsätzliche Entscheidungskriterien für die Auswahl des Transportweges bzw. die Routenauswahl mit Wahl der Schiffsverbindung und somit des entsprechenden Hafens sind der Preis, die Zeit, der Prozess und die Verfügbarkeit. Für jedes zu transportierende Produkt haben diese Kriterien nicht immer die gleiche Gewichtung und bewirken somit grundsätzlich unterschiedliche Bewertungen und Ergebnisse bezüglich der Wahl der Transportroute und der Transportart. Die SECA-Regulierungen können Einflüsse auf die Wahl der Transportroute haben, jedoch ist das nur eines von vielen noch wichtigeren Kriterien. Bei den Kriterien sind u.a. auch Lenkzeiten bzw. Lenkpausen und hochfrequentierte Taktungen der Fährabfahrten gekoppelt mit entsprechenden KV-Shuttleverbindungen von großer Bedeutung.
2.2 Durchführung
Im Rahmen des Gutachtens wurden mehrere Ansätze gesammelt und verfolgt.
1. Ansatz – Makroökonomie:
Als erster Ansatz wurde eine makroökonomische Betrachtung des innereuropäischen Handels inkl. Russland vorgenommen. Grundsätzlich handelt es sich um den Grundgedanken mittels eines vereinfachten klassischen quantitativen Ansatzes nach neuen Entwicklungsrichtungen zu suchen. Entwicklungsrichtungen sind Kombinationen von Geschäftsfeldern und Märkten.
Im ersten Arbeitsschritt wurden Handelsverflechtungen zwischen 30 Ländern (= „Märkte“) betrachtet, die grundsätzlich (beispielsweise aus verkehrsgeographischer Sicht) potenzielle Märkte für den Seehafen Lübeck darstellen. Aus diesen 30 Märkten ergibt sich eine theoretische 30 x 30 Matrix von Handelsrelationen (Reporter x Partner). Dabei ist das Reporterland die Quelle und das Partnerland die Senke des Transportes. Aus diesen 900 Relationen wurden offensichtlich „unsinnige Relationen“ (bspw. Österreich – Italien) ausgeschlossen. Für die verbliebenen Relationen wurde die Gesamtgütermenge, die vom Reporterland in das Partnerland über die Ostsee hätte laufen können, für das Jahr 2013 aus der Außenhandelsstatistik gutartspezifisch ausgewertet. Die Gesamtmenge aller transportierten Güter wurde dann sieben Geschäftsfeldern zugeordnet.
Im zweiten Arbeitsschritt wurden über Leitdaten (wirtschaftliche Kenndaten) Mengen-schätzungen für das Jahr 2030 abgeleitet und dann für jedes Geschäftsfeld die zehn Relationen mit den höchsten Wachstumsraten von 2013 bis 2030 ausgewählt. Diese kritische Betrachtung der makroökonomischen Vorgehensweise zeigte auf, dass sich in nahezu allen sieben TOP 10-Tabellen mindestens die aktuellen TOP 3 des Lübecker Hafens befanden. Dieses Ergebnis deutet u.a. darauf hin, dass die bestehenden Verkehre Lübecks bereits makroökonomisch logischen Kriterien entsprechen. Mit anderen Worten, die aktuelle Ausrichtung des Seehafens Lübeck ist auch gesamtwirtschaftlich nachvollziehbar.
Danach folgte der dritte Arbeitsschritt: eine Multi-Kriterien-Analyse. In der Multi-Kriterien-Analyse wurden anhand von sieben verschiedenen Kriterien die zehn vielversprechendsten Entwicklungsrichtungen (fünf bereits existierende und fünf neue) für den Seehafen Lübeck identifiziert.
Die resultierenden Entwicklungsrichtungen können hier selbstverständlich nur grob benannt werden, weil es sich hierbei auch um strategische Ideen und Marketing handelt. Wichtig ist es jedoch Potenziale zu erkennen, um u.a. das Wachstum in der Umschlagentwicklung des Lübecker Hafens belegen und stützen zu können.
Das Gutachten 6 verfolgt bewusst einen makroökonomischen Ansatz, der Märkte von der Ursprungsquelle bis zum Endziel verfolgt. Dieser hat den Vorteil, dass er die Marktsicht der Akteure besser reflektiert. Im Gegensatz dazu ist die Matrix der Seeverkehrsprognose des Bundes „gebrochen“ aufgebaut, d.h. es werden Verkehre von/nach Lübeck auf der Landseite und von/nach Lübeck auf der Seeseite betrachtet, ohne diese zu verknüpfen. Der entscheidende Unterschied zur Seeverkehrsprognose ist also, dass hier vollständige Transportketten betrachtet werden.
2. Ansatz – generelle Trends & Themen:
Es wurden im Rahmen einer Vorrecherche zum Gutachten 6 Entwicklungstrends und in der Branche diskutierte Themen untersucht und bewertet. Hierbei handelt es sich u.a. um die Frage nach dem Container als Ladungsträger und seine Bedeutung für den RoRo-Fährhafen Lübeck.
Hierbei ist es wichtig herauszuarbeiten, welchen Anteil der Container als Ladungsträger im Lübecker Hafen einnimmt und wie viel zugehörige Hafeninfrastruktur für reine Containerdienste zukünftig benötigt werden.
Bei der Betrachtung der Containertransporte ist der wesentliche Unterschied zwischen dem Überseehandel und dem innereuropäischen Handel entscheidend. Der innereuropäische Transport ist charakterisiert von palettenbreiten Ladungsträgern (z.B. Lkw und Trailer). Der Überseeverkehr hingegen weist nur wenig Palettenaffinität auf. Das bezieht sich auch auf die entsprechende Hafeninfrastruktur der zugehörigen Hafenterminals. Somit haben die 20’(Fuß)- und 40’-Container weite Verbreitung im Überseeverkehr. Im innereuropäischen Containerverkehr müssen Paletten vergleichbar zum Trailer im Container Platz finden. Somit wird hier der 45‘-Container sehr interessant. Der Anteil der Container im innereuropäischen Verkehr wird zunehmen genauso wie das Aufkommen - wie eingangs schon erwähnt – im Handel mit Russland und dem Baltikum und somit zum Teil auch Finnland (Transit Russland). Also ergibt sich ein Wachstumspotenzial in Lübeck für kontinentale Short Sea Ladung, aber nicht als HUB-Port für Überseecontainer.
Um Lübeck als Short Sea Shipping Standort auszubauen, ist die Verfügbarkeit von Krananlagen und einer leistungsstarken Schienenanbindung von großer Bedeutung. Die Leistungsfähigkeit des Bahnumschlags ist ein Standortkriterium für Short Sea-Reedereien bei der Standortwahl. Zudem ist die Verfügbarkeit von Supra- und Infrastruktur für die Kunden entscheidend. In der Tabelle 1 ist die Containerumschlagsprognose für den Hafen Lübeck ersichtlich.
| Gesamt [TEU] | Veränderung zum Basisjahr [%] | Umschlaganteil RoRo [TEU] | Veränderung zum Basisjahr [%] | Umschlaganteil LoLo [TEU] | Veränderung zum Basisjahr [%] |
Basisjahr 2014 | 146.000 | 0 | 122.300 | 0 | 23.700 | 0 |
Seeverkehrsprognose für 2030 | 253.624 | + 74 | k.A. |
| k.A. |
|
Potenzial Gutachten 6 für 2030 | 340.000 | + 133 | 180.000 | + 47 | 160.000 | + 575 |
Tab. 1 – Umschlagprognosen Container (RoRo & LoLo) für den Lübecker Hafen (k.A. = keine Angaben)
3. Ansatz – lübeckspezifische Trends:
Hierbei handelt es sich um Entwicklungsrichtungen, die im Rahmen der geführten Expertengespräche benannt oder angesprochen wurden.
Lebensmittel aus Westeuropa sind in Russland und den Baltischen Staaten stark nachgefragte Produkte. Deshalb waren Lebensmittelexporte nach Russland vor Inkrafttreten der Sanktionen ein hauptsächlicher Treiber für RoRo- und Containerverkehre von Lübeck nach Russland, Finnland und Litauen.
2.3 Fazit
Der Hafen Lübeck ist und bleibt stark.
Das Gutachten gibt keine Patentlösungen oder präsentiert neue unterschriftswillige Kunden. Es liefert vielmehr einen kleinen Einblick wie Komplex das Transportsystem funktioniert und wie es zugunsten des Hafens Lübeck genutzt werden kann.
Der Markt (basierend auf Experten-Interviews) sieht durch die FFBQ eine Verlagerung von ca. 10% der Umschlagmenge von Lübeck auf die FFBQ. Damit liegt diese Einschätzung unterhalb der Seeverkehrsprognose. Ein hafenspezifischer Nutzen für Lübeck durch die FFBQ wird nicht gesehen.
Die Handelsbeziehungen zu Russland werden sich mittel- bis langfristig verbessern. Somit ist im Rahmen des HEP die Vorbereitung auf den zukünftigen Russlandverkehr erforderlich, da Russland langfristig ein wichtiger Markt für den Standort Lübeck wird. Bestrebungen, die Verkehre von/nach Russland auszubauen, sollten vorangetrieben werden, damit sie bei einer Entspannung der politischen Situation umgehend umgesetzt werden können.
Insgesamt ergeben sich folgende Entwicklungsrichtungen, deren weiterer Prüfung es bedarf:
- LoLo-Containerumschlag (Short Sea Shipping)
- Projektladung & Schwergut (mit Krananlagen)
- RoRo als das Premiumprodukt
- Lebensmittellogistik
- Stückgutumschlag
- Massengut
- RoPax-Passagier-/Personenbeförderung - Marktpotenzial im Passagierfährverkehr
- Prüfung und Priorisierung des Marktpotenzials der Kreuzschifffahrt/des Kreuzfahrtgeschäfts
3 Empfehlungen
Folgende Empfehlungen ergeben sich:
- Prüfung der verschiedenen Umschlagpotenziale aus Kapitel 2.3 und Übertragung in die zukünftige Ladungsträgerstruktur des Lübecker Hafens;
- Aufbau und Bildung von Supply Chains durch die Kooperation aus Spediteuren, Hafenoperateuren und Reedereien;
- Weiterer Ausbau des Premiumprodukts RoRo;
- Steigerung der KV-Volumina;
- Steigerung der politischen/landespolitischen Arbeit für den Hafen;
- Mitarbeit im Arbeitskreis EU-TEN-T-ScanMed-Korridor.
4 Nächste Schritte beim HEP2030
- Kenntnisnahme und Diskussion der Ergebnisse der übrigen Grundlagengutachten;
- Übernahme aller bis dahin vorhandenen Ergebnisse ins Gutachten 3 (Hafenumschlagprognose Lübeck für 2020, 2025 und 2030);
- Bearbeitung Block 3 läuft seit 1. Quartal 2015;
- HEP-Bearbeitung im Block 4 läuft seit 1. Quartal 2016.
Anlagen
Kurzfassung des Gutachtens 6
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
| 1 | öffentlich | Anlage 1_Kurzfassung G6 (1438 KB) | |||