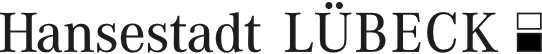Bürgermeister Jan Lindenau und Bausenatorin Joanna Hagen gaben gemeinsam mit Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide die neue Stadtgrabenbrücke frei.
Copyright HL
Nach rund 17 Monaten Bauzeit wurde heute die neue Stadtgrabenbrücke eingeweiht. Ab sofort ermöglicht sie Fußgänger:innen und Radfahrenden eine schnelle Verbindung zwischen St. Lorenz und der Altstadt.
„Die Stadtgrabenbrücke steht nicht nur als Symbol für die nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität in der Hansestadt, sondern wird von nun an auch dazu beitragen, dass Lübecks Geh- und Radwege sicherer werden. Als Verbindung wichtiger Verkehrsachsen mit der Altstadtinsel stellt sie eine wesentliche Verbesserung für die Arbeits- und Freizeitwege vieler Lübeckerinnen und Lübecker dar“, erklärte Bürgermeister Jan Lindenau.
„Mit dem Neubau der Stadtgrabenbrücke konnte ein großer Schritt in Richtung eines modernen und sicheren Verkehrskonzepts für die Hansestadt getan und gleichzeitig der Schutz des umliegenden Naturraums berücksichtigt werden. Auch bei der Auswahl der beim Bau verwendeten Materialien konnte eine Kombination aus Nachhaltigkeit und geringerem Wartungsbedarf für die Zukunft erreicht werden. Diesen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unserer städtischen Infrastruktur konnten wir dank der Förderung durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr erreichen“, erklärte Bausenatorin Joanna Hagen.
„Mit der neuen Stadtgrabenbrücke haben die Menschen in Lübeck eine sichere und komfortable Verbindung. Solche Projekte sind wichtig, um mehr Menschen für das Radfahren zu begeistern. Das entspricht genau dem Ziel unserer Radstrategie und deshalb ist die Förderung hier auch gut angelegtes Geld. Ich freue mich, dass die Brücke jetzt für den Verkehr freigegeben ist“, betonte Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide.
Ausgehend von dem Platz am Ende der Werner-Kock-Straße führt der neue Geh- und Radweg zur Willy-Brandt-Allee hinunter. Auf einer Länge von 120 Metern wird ein Höhenunterschied von etwa 3,20 Metern überwunden. Durch die Länge der Brücke mit anschließender Rampe ergibt sich ein stetiges Gefälle von maximal drei Prozent. Somit konnte auf Stufen und Ruhepodeste vollständig verzichtet werden, so dass die Nutzung für mobilitätseingeschränkte Menschen und den Radverkehr gleichermaßen komfortabel ist.
Stadtgrabenbrücke fügt sich optimal in ihre Umgebung ein
Die Brücke ist 63,20 Meter lang und von Geländer zu Geländer 6,50 Meter breit. Auf hoch aufragende Bauteile wie Bögen oder Pylone wurde bewusst verzichtet. Mit dem Bau als Dreifeldbauwerk wird eine sinnvolle und wirtschaftliche Aufteilung der Gesamtstützweite erreicht, ohne störende Pfeiler in den Flusslauf zu stellen. Durch die Eingliederung der benötigten Pfeiler in die vorhandenen Baumreihungen wurde die Brücke bestmöglich in ihre Umgebung integriert.
Durch die Ausnutzung der Brückenlänge für das Gefälle kommt die Rampe mit einem Damm von geringer Höhe aus, der vollständig begrünt ist. Damit entfiel der Bau von Stützbauwerken und Beton- oder Stahlflächen wurden auf ein Minimum reduziert.
Langlebigkeit des Bauwerks und Schutz der Umwelt bei Planung von großer Bedeutung
Bei der Planung der Brücke wurde zudem darauf geachtet, sensibel mit dem Naturraum des Stadtgrabens umzugehen. Durch die schlanken Pfeiler erfolgte in unmittelbarer Ufernähe nur ein minimaler Eingriff, der durch die Verwendung von Verpresspfählen (Pfähle mit einem besonders kleinen Durchmesser von unter 30 Zentimetern) unterstützt wurde. Durch die minimierten Widerlager kann der Raum in den Seitenöffnungen offen bleiben für die Biotopvernetzung (z. B. für den Otter) und für die Naherholung auf dem östlichen Uferweg.
Als Fahrbahnplatte wurde ein Carbon-bewehrter Beton verwendet. Durch die nichtrostenden Bewehrungselemente konnte die Fahrbahnplatte vergleichsweise dünn und gewichtsparend gestaltet werden, was zu Einsparungen von Beton und Stahl führt.
Die Stadtgrabenbrücke ist das erste Bauwerk dieser Größenordnung in der Hansestadt Lübeck, dass vollständig spritzverzinkt ist. Auch deutschlandweit ist dieses Verfahren noch nicht sehr verbreitet. Mit der Spritzverzinkung wurde ein lebenslanger Korrosionsschutz aufgebracht, der nicht wie bei den üblichen Beschichtungen nach etwa 30 Jahren erneuert werden muss. Lediglich aus optischen Gründen (Farbgebung) wurde eine konventionelle Deckbeschichtung aufgebracht, die in Zukunft mit deutlich geringerem Aufwand erneuert werden muss.
Insgesamt wurden 6,7 Millionen Euro in das neue Brückenbauwerk investiert. Der Bund hat den Neubau mit rund 50 Prozent der Gesamtkosten aus dem Förderprogramm „Stadt und Land“ unterstützt.
+++